Artikel teilen
Artikel
Fünf Fragen in den Süden zur Coronakrise
22.06.2020, Internationale Zusammenarbeit
Was bedeutet die Coronakrise für die Menschen im globalen Süden? «global» hat fünf Menschen aus fünf Ländern befragt. Ein Schlaglicht ohne Anspruch auf Repräsentativität.
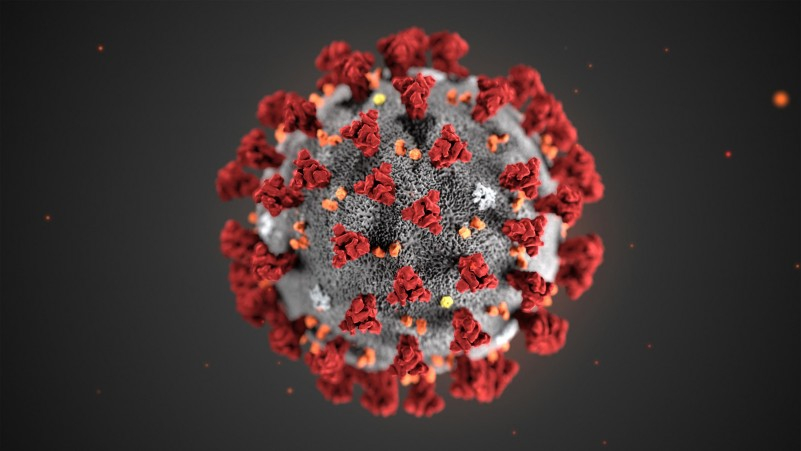
Ravikant Tupkar, Leiter der Bauernorganisation Swabhimani in Maharashtra, Indien

Ravikant Tupkar
- Wie erleben Sie persönlich die Coronakrise?
Die Regierung beschuldigt die Muslime und vernachlässigt ihren Auftrag, die Grundbedürfnisse aller zu decken. Umso grösseren Respekt habe ich vor jenen, die auch ohne ausreichende Schutzausrüstung gegen die Verbreitung des Virus kämpfen. - Welche Ihrer Freiheiten wurden eingeschränkt?
Die Regierung hat die Bewegungsfreiheit radikal eingeschränkt und setzt das strikt durch. Ernte auf dem Markt zu verkaufen, bleibt erlaubt. Wer sich nicht ans social distancing hält, kann bestraft werden, dasselbe gilt für Meinungsäusserungen im Internet. - Wie wirkt sich die Krise in Ihrem Land auf die verletzlichsten Menschen aus?
Kleine Betriebe verlieren die Existenzgrundlage, immer mehr Menschen landen auf der Strasse. Auch Leute mit einer Ausbildung verlieren ihre Arbeit, wahrscheinlich wird die Zahl der Bauern, die sich aus Verzweiflung das Leben nehmen, ansteige - Was werden die Folgen der Coronakrise sein?
Die religiösen Spannungen drohen zu eskalieren, Mobbing und Ausschreitungen zuzunehmen. Die Abriegelung war für die Wirtschaft verheerend. Sollten jetzt auch noch ausländische Unternehmen ihre Investitionen abziehen, wäre das katastrophal. - Gibt es auch Anlass zur Hoffnung?
Ich bete, dass mein Land und auch der Rest der Welt diese Krankheit schnell und sicher überwinden mögen.
Angela Ospina Rincón, Direktorin des Zentrums für psychosoziale Betreuung in Bogotà, Kolumbien

Angela Ospina
- Wie erleben Sie persönlich die Coronakrise?
Ich bin sehr besorgt über die zunehmende Verletzung der Menschenrechte und haben unsere Arbeit neu ausgerichtet. Im Zentrum stehen Denunziation und die Auswirkungen der Ausgangssperre für die über 70jährigen auf deren elementare Menschenrechte. - Welche Ihrer Freiheiten wurden eingeschränkt?
Abgesehen von den Alten setzt Kolumbien auf Herdenimmunität, das verstärkt das bestehende Gefühl der Unsicherheit. Die Opposition war schon vorher stark eingeschränkt. Die Regierung nutzt die Pandemie, um ihre Agenda voranzubringen. - Wie wirkt sich die Krise in Ihrem Land auf die verletzlichsten Menschen aus?
Die Pandemie wirft ein Schlaglicht auf die extreme Ungleichheit in Kolumbien, die hier am zweitstärksten ausgeprägt ist in Lateinamerika. Die Ärmsten leiden Hunger, ihre Proteste werden mit Tränengas, Schlägen und Verhaftungen unterdrückt. - Was werden die Folgen der Coronakrise sein?
Armut, Hunger und Arbeitslosigkeit werden zunehmen. Es wird zu sozialen Unruhen kommen. Wenn das Virus uns nicht tötet, ist es der Hunger. Präsident Duque regiert zu Gunsten seiner Anhänger gegen das Volk, öffentliche Mittel werden zweckentfremdet. - Gibt es auch Anlass zur Hoffnung?
Ja, inmitten grosser Repression gibt es aus der Mitte der Bevölkerung eine grosse Welle der Solidarität. Soziale und Menschenrechtsorganisationen haben ihre Arbeit unter schwierigsten Bedingungen aufrechterhalten.
Djalma Costa, Direktionsmitglied des Kinderrechtszentrums CEDECA in Sao Paulo, Brasilien

Djalma Costa
- Wie erleben Sie persönlich die Coronakrise?
Die Dimension, welche die Gesundheitskrise in Brasilien annimmt, bereitet mir allergrösste Sorgen. Dies vor allem auch, weil wir keine verlässliche politische Führung haben, die den BrasilianerInnen mehr Sicherheit vermittelt. - Welche Ihrer Freiheiten wurden eingeschränkt?
Die verordnete Quarantäne hat eine direkte Auswirkung auf unsere Bewegungsfreiheit. Aber ich anerkenne, dass sie notwendig ist. Von zu Hause aus zu arbeiten, emfinde ich als sehr schwierig. - Wie wirkt sich die Krise in Ihrem Land auf die verletzlichsten Menschen aus?
Die arme, ausgegrenzte Bevölkerung ist am meisten betroffen. Es fehlt ihr an fast allem. Präsident Bolsonaro verhält sich wie ein Feind der Verletzlichsten und arbeitet aktiv gegen die Behörden und die Gouverneure der Bundesstaaten. - Was werden die Folgen der Coronakrise sein?
Die Wirtschaftskrise, die auf uns zukommt, wird beispiellos sein. Die drängendste Frage wird die Ernährungssicherheit betreffen, aber auch das Fehlen von Arbeitsplätzen, um wieder in Würde zu leben. Psychische Erkrankungen werden zunehmen. - Gibt es auch Anlass zur Hoffnung?
Menschen haben die Fähigkeit, sich neu zu erfinden, das gibt mir Mut. Im Moment ist die Stimmung in Brasilien zwar von einer grossen Entmutigung geprägt, doch der Kampf ist unser täglicher Begleiter.
Sambu Seck, Generalsekretär der Bauernorganisation KAFO, Guinea-Bissau

Sambu Seck
- Wie erleben Sie persönlich die Coronakrise?
Die Pandemie bestimmt mein tägliches Leben, sowohl privat als auch beruflich. Erstmals in meinem Leben fühle ich mich der volkstümlichen Wärme der bäuerlichen Gemeinschaften und ihrer spontanen, liebevollen Art beraubt. - Welche Ihrer Freiheiten wurden eingeschränkt?
Die Behörden haben die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt, um die Ansteckungsgefahr zu mindern. Als aktives Mitglied der Zivilgesellschaft trage ich das mit, meine Arbeit läuft strikt nur noch über digitale Kanäle. - Wie wirkt sich die Krise in Ihrem Land auf die verletzlichsten Menschen aus?
Nur 38% der Bevölkerung hat Zugang zu Gesundheitsdiensten. Unter den Verwundbarsten sät das Coronavirus als unsichtbarer Feind Angst und Schrecken. Unkenntnis über Ursprung und Umgang mit der Bedrohung verheissen nichts Gutes. - Was werden die Folgen der Coronakrise sein?
Die Gefahren einer akuten Nahrungsmittel- und Gesundheitskrise sind offensichtlich. Unsere Wirtschaft hängt stark von der Landwirtschaft ab, insbesondere der Produktion von Cashewnüssen. Der Export ist jedoch völlig zusammengebrochen. - Gibt es auch Anlass zur Hoffnung?
Guinea-Bissau hat relativ schnell mit präventiven gesundheitlichen und wirtschaftlichen Massnahmen auf diese globale Krise reagiert. Je besser wir alle zusammenstehen, desto eher wird ein schrittweiser Ausweg aus der Krise möglich sein.
Risa Hontiveros, Senatorin im philippinischen Parlament, Manila

Risa Hontiveros
- Wie erleben Sie persönlich die Coronakrise?
Auch die Philippinen setzen die sozialen Distanzierungs- und Quarantänemassnahmen strikt um. Das bedeutet u.a., dass ich mich aus der Ferne um meine alte Mutter kümmern muss. Auch andere geliebte Menschen habe ich seit Wochen nicht mehr gesehen. - Welche Ihrer Freiheiten wurden eingeschränkt?
An erster Stelle ist klar die Einschränkung der Bewegungsfreiheit zu erwähnen. Als Staatsangestellte bin ich davon allerdings – wie das Personal im Gesundheitswesen oder im Detailhandel – etwas weniger stark betroffen. - Wie wirkt sich die Krise in Ihrem Land auf die verletzlichsten Menschen aus?
Die Coronakrise trifft die Verwundbarsten am härtesten. Viele Filipinos arbeiten nach dem Prinzip «keine Arbeit, kein Lohn». Trifft Covid-19 eine bereits arme Familie, wird es für sie extrem schwierig, Die Regierung müsste jetzt alles tun, um die Schwächsten zu schützen. - Was werden die Folgen der Coronakrise sein?
Mit der Pandemie endet eine 21-jährige Wachstumsphase, eine Rezession scheint unvermeidlich. Noch mehr beunruhigt mich die Aushöhlung der Demokratie, die Unterdrückung der bürgerlichen Freiheiten und der Menschenrechte. Der Überwachungsstaat ist auf dem Vormarsch. - Gibt es auch Anlass zur Hoffnung?
Es war und ist herzerwärmend zu sehen, wie sich die Filipinos gegenseitig helfen. Hoffnung gibt mir auch, wie sie landesweit gegen die Abschaltung eines populären TV-Kanals protestierten. Auch der Kampf gegen die Offshore-Glücksspielindustrie geht weiter. Filipinos verteidigen ihre Rechte.
Artikel
Die Zivilgesellschaft vor Ort direkt unterstützen!
19.08.2020, Internationale Zusammenarbeit
Nur etwa 1% der OECD-Entwicklungsgelder kommt direkt zivilgesellschaftlichen Organisationen vor Ort zu gut. Die Stimmen mehren sich, die finden, das sei viel zu wenig, Entwicklung müsse grundsätzlich neu gedacht werden.

© M. Mamontov / Pixabay
Organisationen der Zivilgesellschaft (CSOs) sind von entscheidender Bedeutung für die Erreichung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung (SDGs), wie sie die Uno in der Agenda 2030 formuliert hat. Ob es um Demokratisierung, die Verteidigung der Menschenrechte oder den Schutz der Umwelt geht: Nur wenn engagierte Bürger*innen ihre Regierungen und Unternehmen zur Rechenschaft ziehen (können), kann sich eine Gesellschaft nachhaltig entwickeln, ohne dass einzelne Gruppen von der Entwicklung abgehängt werden. Allerdings – und das ist ein weltweit beobachtetes und gravierendes Problem – wird der Handlungsspielraum für zivilgesellschaftliches Engagement in vielen Ländern zunehmend eingeschränkt und beschnitten. Das reicht von immer restriktiverer Gesetzgebung über administrative Hürden bis zu Verleumdungskampagnen und politischer Verfolgung von Aktivist*innen.
Das Hauptproblem für viele Organisationen in Entwicklungs- bzw. Schwellenländern ist dabei der Zugang zu Finanzmitteln, speziell gilt das für jene, die sich für die Menschenrechte engagieren. Eine kürzlich veröffentlichte OECD-Studie zeigt, dass fast alle Mitglieder des Entwicklungshilfeausschusses der OECD (OECD-DAC) Organisationen der Zivilgesellschaft unterstützen – rund 15% der bilateralen öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) wurden 2018 dafür eingesetzt. Allerdings floss der grösste Teil dieser Gelder an gut organisierte NGOs aus den Geberländern gefolgt von international tätigen NGOs, nur etwa 1% der gesamten bilateralen Entwicklungsgelder ging an lokale Organisationen in den Entwicklungsländern. Die DAC-Studie zeigt zudem, dass zivilgesellschaftliche Organisationen präferentiell als Umsetzungspartnerinnen für Projekte und Prioritäten der Geberländer eingesetzt werden und nur selten als eigenständige Entwicklungsakteurinnen angesehen werden.Von den rund 20.5 Milliarden US-Dollar, die 2018 aus den OECD-Ländern an den gesamten CSO-Sektor gingen, flossen nur etwa 3 Milliarden direkt in die eigenen Programme der CSOs. Etwa 17 Milliarden oder 85 Prozent der Gelder wurden für Programme und Ziele ausgegeben, die von den (staatlichen) Gebern erarbeitet worden waren.
Fragwürdige Messbarkeit
Der Druck, messbare Ergebnisse zu liefern, ist einer der Gründe weshalb die Geber es vorziehen, CSOs vor allem als Umsetzerinnen zu nutzen, anstatt die Kernfinanzierung für deren eigene Arbeit bereitzustellen. So nannte die Mehrheit der befragten OECD-DAC-Mitglieder die Notwendigkeit, Erfolge auszuweisen einen Schlüsselfaktor für ihre Entscheidungsfindung. Wir alle wissen jedoch, dass nicht alles messbar ist und dass integrative politische Prozesse Zeit brauchen, um Ergebnisse zu erzielen. Kommt dazu, dass bürokratische Anforderungen an die Berichterstattung kleinere, informelle Organisationen der Zivilgesellschaft vor besondere Schwierigkeiten stellen. Nicht selten beginnen lokale CSOs gar, ihre Programme auf die Präferenzen der Geber statt auf die tatsächlichen Bedürfnisse vor Ort auszurichten. Damit wird auch eine paternalistische Vision von Entwicklung aufrechterhalten, die westliches Fachwissen und Know-how viel höher schätzt als lokale Expertise.
Wie kann sich das ändern? Die OECD-DAC-Studie enthält mehrere Vorschläge und Empfehlungen, von denen im Folgenden drei skizziert werden. Eine Empfehlung, die sich auf die zu einseitige Ergebnisorientierung bezieht, lautet, es müssten Wege gefunden werden, um «zu zeigen, dass die Stärkung einer pluralistischen und unabhängigen Zivilgesellschaft ein wertvolles Entwicklungsergebnis ist». Dies steht auch im Einklang mit einem kürzlich veröffentlichten Leitfaden der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), in dem es heisst, der Erhalt des Raums für die Zivilgesellschaft sei durchaus ein Ergebnis an sich. Sowohl die DAC-Studie als auch der Leitfaden der DEZA anerkennen die Notwendigkeit, den Süd-CSOs mehr Grundfinanzierung zur Verfügung zu stellen, sich mit informelleren Abläufen zufriedenzugeben und andere, flexiblere Finanzierungsmodalitäten einzuführen.
Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Notwendigkeit, Raum für gegenseitiges Lernen und Austausch zu schaffen - zwischen Gebern und zivilgesellschaftlichen Organisationen auf Länderebene; zwischen den Organisationen und politischen Entscheidungsträger*innen sowie zwischen CSOs und Bürger*innen. Jegliche Art des Austausches sollte allerdings auf einer guten Machtanalyse basieren, um sicherzustellen, dass auch die am stärksten marginalisierten Gruppen gehört werden. Austausch und Dialog sind wichtig um gemeinsame Strategien für die Stärkung und politische Teilhabe der Zivilgesellschaft zu entwickeln, starke Kommunikation muss den öffentlichen Nutzen einer starken Zivilgesellschaft aufzeigen und den CSO bei der Verankerung in ihrem Land helfen.
Drittens – auch das erwähnen sowohl die OECD-DAC-Studie wie auch der Leitfaden der DEZA – muss die internationale Entwicklungsgemeinschaft ihre Stimme, ihre Netzwerke und ihren Einfluss nutzen, um sich für jene einzusetzen, die tagtäglich Einschüchterungen, Repression und Sicherheitsrisiken ausgesetzt sind. Dazu gehört, dass diplomatische Kanäle genutzt und die Staaten verpflichtet werden, gegen Straflosigkeit zu kämpfen, indem sie wirksame Untersuchungen von Menschenrechtsverletzungen fordern.
Politikkohärenz endlich ernst nehmen
All dies sind letztlich Fragen der Politikkohärenz, die für die Beteiligung der Zivilgesellschaft von entscheidender Bedeutung ist. Politikkohärenz für eine nachhaltige und gerechte Entwicklung bedeutet, die Rechte der ärmsten und am stärksten marginalisierten Mitglieder der Gesellschaft, den Schutz der Menschenrechte und den Schutz der Umwelt in allen Politikbereichen in den Mittelpunkt zu stellen. Es bedeutet, eine integrative Wirtschafts-, Steuer- und Handelspolitik zu verfolgen, die den Schwächsten und nicht den Eliten und Unternehmen zugutekommt. Es bedeutet nicht nur eine auf die Menschen ausgerichtete Migrations- und Sicherheitspolitik, die alle mit Würde und Respekt behandelt, sondern auch eine Klimapolitik, die den Ernst und die Dringlichkeit der aktuellen Notlage anerkennt.
Die Akteure der Entwicklungszusammenarbeit müssen nicht nur die besagten Politikbereiche beeinflussen, ebenso konsequent sollten sie sich um Politikkohärenz innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit bemühen. Dazu gehören die bilaterale und multilaterale Entwicklungszusammenarbeit ebenso wie die Bereiche Klimafinanzierung und gemischte Finanzierung (Blended Finance), die in den öffentlichen Entwicklungsausgaben der OECD-Länder immer mehr Raum einnehmen. Was das verstärkte Engagement der Geber mit dem Privatsektor betrifft, so ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Zivilgesellschaft im Norden wie im Süden aktiv konsultiert und in alle Aktivitäten einbezogen wird. Es ist untragbar, dass Entwicklungsakteure mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten, die in Unterdrückung, Korruption oder Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind. Darüber hinaus sind alle DAC-Mitglieder auch Mitglieder multilateraler Entwicklungsbanken; dort sollten sie ihr Stimmrecht nutzen, um sicherzustellen, dass die Banken die Zivilgesellschaft bei all ihren Aktivitäten angemessen konsultieren. Dies ist umso wichtiger, als eine kürzlich von der Koalition für Menschenrechte in der Entwicklung durchgeführte Studie gezeigt hat, dass ein Grossteil der Repressionen gegen Menschenrechtsverteidiger*innen und Umweltaktivist*innen im Zusammenhang mit «Entwicklungsprojekten» stattfindet, die von Entwicklungsbanken finanziert werden.
In einer Zeit globaler Krisen, globaler Proteste, aber auch des globalen Aufbruchs muss sich auch der Entwicklungssektor ehrlich und dringend die Frage stellen, welche Art von Entwicklung er fördern will. Eine Entwicklung, die wirtschaftliches Wachstum auf Kosten der Menschen und der Umwelt fördert und mit der wir den Menschen im Süden unsere Modelle und Entwicklungsstrategien aufzwingen? Oder eine Entwicklung, die den Menschen und die Umwelt an die erste Stelle setzt, die auf globaler Solidarität und auf der Erkenntnis aufbaut, dass wir alle Entwicklungsländer sind, dass wir alle voneinander lernen können und dass wir alle zusammenarbeiten müssen, um eine belastbare, nachhaltige und gerechte Zukunft für alle aufzubauen?
Artikel teilen
Artikel
150 Mio USD für Klima statt für Entwicklung
20.08.2020, Internationale Zusammenarbeit
Der Bundesrat hat am 19. August 2020 beschlossen, 150 Millionen US-Dollar aus dem künftigen Rahmenkredit der Entwicklungszusammenarbeit an den Grünen Klimafonds zu überweisen. Alliance Sud kritisiert diese Zweckentfremdung von Entwicklungsgeldern.

von Jürg Staudenmann, ehemaliger Fachverantwortlicher «Klima und Umwelt»
Kein Zweifel: Gerade in Entwicklungsländern werden Klimaschutz und Anpassung an die Klimaveränderung je länger desto dringender. Dafür lenkt die Schweiz ebenso dringend benötigte Entwicklungsgelder um. Das widerspricht nicht nur klar dem Pariser Klimaübereinkommen, es läuft auch den Grundätzen wirkungsvoller Entwicklungszusammenarbeit (EZA) zuwider. Dabei hat Alliance Sud schon mehrfach aufgezeigt, wie bereits heute die nötigen Gelder nach dem Verursacherprinzip bereitgestellt werden könnten.
Die steigenden Kosten für dringende Klimaschutz- und Anpassungsmassnahmen im globalen Süden verlangen nach zusätzlichen Mitteln. Für die Wiederauffüllung des Grünen Klimafonds (Green Climate Fund), der Klimaprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern finanziert, wurde deshalb eine Verdopplung der Einlagen der Industrieländer erwartet. Während das einige Länder auch zugesagt haben, will die Schweiz ihren Beitrag nun lediglich um 50% erhöhen. Das ist knausrig und kurzsichtig.
Noch problematischer ist, dass die am 19. August vom Bundesrat gutgeheissenen 150 Millionen USD nicht zusätzlich gesprochen wurden, sondern aus der ohnehin schon zu knapp bemessenen EZA umgelenkt werden. Dieses Geld steht damit nicht mehr für die Kernaufgaben der Entwicklungszusammenarbeit – die Verringerung von Armut und Ungleichheit – zur Verfügung.
Dass Emissionsminderung und Armutsbekämpfung verschiedene Absichten und Zielgruppen haben, leuchtet ein (siehe dazu auch das Positionspapier von Alliance Sud). Denn bei den Ärmsten lassen sich kaum nennenswert Emissionen verringern. Selbst sinnvolle und wirksame Klimaanpassungsprojekte sind auf künftige Bedrohungen der Klimaveränderung ausgerichtet, nicht aber auf die unmittelbare Verbesserung der Lebensumstände der ärmsten Bevölkerung. Das jedoch ist ein Grundsatz guter Entwicklungszusammenarbeit und mithin Voraussetzung für den Einsatz von Entwicklungsgeldern. – Aus genau diesem Grund verlangt das Pariser Klimaübereinkommen „neue und zusätzliche“ Mittel.
Dass die bisherige Schweizer Klimafinanzierung in der Tat zum allergrössten Teil weder Ärmsten noch von der Klimakrise am meisten Gebeutelten zu Gute kommt, hat eine von Alliance Sud in Auftrag gegebene Studie («Der Schweizer Beitrag an die internationale Klimafinanzierung») erst kürzlich aufgezeigt.
Für Alliance Sud ist klar: Klimaschutz zu Lasten der Kernaufgabe der Entwicklungszusammenarbeit geht in die falsche Richtung! Denn es besteht durchaus die Möglichkeit, nach dem Verursacherprinzip erhobene Gelder für internationale Klimafinanzierung einzusetzen. Ein Rechtsgutachten vom Februar 2019 hat dargelegt, dass auch eine Teilzweckbindung von Klima-Lenkungsabgaben dafür sowohl verfassungskonform als auch zielführend wäre.
Alliance Sud kritisiert mit Nachdruck, dass solche Optionen bisher weder von Bundesrat noch vom Parlament in Betracht gezogen wurden. Denn internationaler Klimaschutz auf Kosten der Entwicklungszusammenarbeit zu finanzieren, ist der falsche Weg.
Artikel teilen
Artikel
«Lokale Bevölkerung kennt Bedürfnisse am besten»
05.10.2020, Internationale Zusammenarbeit
Nach einem EDA-Diplomaten, der am Ende seiner Berufslaufbahn stand, leitet seit dem 1. Mai Patricia Danzi die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA). Im «global»-Gespräch setzt sie erste Schwerpunkte.

global: Sie arbeiteten zuletzt als Afrika-Verantwortliche für das IKRK, jetzt sind Sie für die humanitäre Hilfe (HH) und die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) der Schweiz verantwortlich. Wie verhalten sich HH und EZA zueinander?
Patricia Danzi: Das hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert und entwickelt. Konflikte dauern länger, der Klimawandel, ein Thema mit enormen Auswirkungen, ist hinzugekommen. Die HH lässt sich mit der Feuerwehr vergleichen; es muss schnell gehen, um einen Brand zu löschen. Wenn Konflikte jedoch andauern und ungelöst bleiben, dann stellen sich beim Wiederaufbau andere Fragen als etwa bei einem Erdbeben oder einer Flutkatastrophe. Man kann nicht über Jahre mit Wasser-Tankwagen in einem Lager mit Vertriebenen vorfahren. In einem solchen Fall braucht es Lösungen, wo HH und EZA zwingend Hand in Hand arbeiten müssen. Zwar sind die Aufgaben, die nötigen Kompetenzen von HH und EZA unterschiedlich, aber die Ziele müssen unbedingt und immer aufeinander abgestimmt sein.
Aufgrund ihrer Erfahrung beim IKRK gibt es Befürchtungen, die humanitäre Hilfe liege Ihnen näher als die langfristige bilaterale Entwicklungszusammenarbeit...
Das soll später einmal beurteilt werden (lacht). Im Ernst: Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit Menschen vor Ort kenne ich den Zusammenhang zwischen kurzfristiger Nothilfe und langfristiger Entwicklungsarbeit sehr gut. Die Prioritäten von Menschen in unmittelbarer Notlage können sich schnell in Richtung existentieller, längerfristiger Probleme wie Ausbildung oder Arbeit verschieben. Ich habe in meiner bisherigen Tätigkeit die Grenzen erlebt, an welche die Nothilfe zwangsläufig stösst, und suchte eine neue, darüber hinausgehende Herausforderung.
Wenn ein fragiler Staat wie Burkina Faso, wo die Schweizer EZA seit Jahren erfolgreich engagiert ist, immer mehr mit interner Gewalt und Vertreibungen konfrontiert ist, wenn Schulen und Gesundheitseinrichtungen aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müssen, dann ist leider auch wieder der Einsatz von HH gefragt; gerade auch, um das bereits durch die EZA Erreichte zu schützen. So oder so muss die Bevölkerung immer in unsere Arbeit einbezogen sein, denn sie weiss mit Abstand am besten, welche Bedürfnisse sie kurz- und längerfristig hat.
Die Qualität der HH misst sich an ihrer Fähigkeit zur raschen Reaktion in der Krise. Gibt es auch einen so prägnanten und wahren Satz zur EZA?
Gute EZA ist längerfristig aufgestellt, nur so kann sie ihre Wirkung entfalten. Sie erzielt auf vielleicht weniger spektakuläre, aber nachhaltige Weise die gewünschten Ergebnisse. In einigen Ländern ist die DEZA schon seit Jahrzehnten vertreten und hat, so berichten es mir die Schweizer BotschafterInnen dort, den Ruf einer transparenten und verlässlichen Partnerin.
Wie kann man der Gefahr entgegenwirken, dass eine Entwicklungsagentur wie die DEZA eine Rolle übernimmt, die eigentlich die betroffenen Staaten selbst hätten?
Es gilt immer und überall, gute Regierungsführung einzufordern. Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei die Zivilbevölkerung, die junge Bevölkerung etwa, die ganz anders mit den digitalen Möglichkeiten, mit den sozialen Medien umzugehen weiss. Zwar braucht es ein gewisses Mass an Freiheit, damit die Bevölkerung selbst eine Kontrollfunktion ausüben kann. Doch wenn die Leute etwa wissen, dass die Schweiz zwei Millionen für den Bau eines Spitals gesprochen hat, und es geht mit dem Bau nicht vorwärts, dann werden sie sich wehren. Das ist heute anders als noch vor zwanzig Jahren. Auch in dieser Beziehung ist Transparenz ein entscheidender Faktor.
In den letzten Jahren ist die messbare Wirkung der EZA immer wichtiger geworden. Geldgeber wie auch die Steuerzahlenden wollen wissen, was ihr Geld bewirkt.
Das stimmt, heute muss man nicht bloss nachweisen, wie viele Moskitonetze verteilt wurden, sondern auch, wie stark dadurch die Verbreitung der Malaria abgenommen hat, am besten detailliert aufgeschlüsselt nach Region, Altersgruppen und Geschlechtern. Ich verstehe diesen Wunsch nach Rechenschaft über unsere Arbeit. Es ist auch ganz wichtig, dass wir Situationen genau analysieren, bevor wir aktiv werden. Aber gleichzeitig ist es schwierig zu messen, welche Probleme dank unserer Arbeit nicht aufgetreten sind, dank Prävention zum Beispiel. Wenn man in gute Regierungsführung oder in die Beteiligung der Zivilgesellschaft an Entscheidungsprozessen investiert, dann ist das Ergebnis schwierig zu messen.
Auch nicht direkt Messbares kann also ausgesprochen relevant sein?
Ja, darum ist es so wichtig, anhand von konkreten Beispielen zu erklären, welche Bedeutung etwa der Aufbau von Netzwerken hat. Es lässt sich selbstverständlich belegen, wenn wir zum Beispiel so und so viele Leute ausgebildet haben, die in einer Gemeinschaft eine wichtige Rolle innehaben. Will man aber in einem Land die Rechtsstaatlichkeit fördern – und das gehört genauso zu unseren vordringlichen Anliegen wie gute Regierungsführung – ist das schwieriger messbar, dann muss man konsequent darauf hinarbeiten und es unserer Öffentlichkeit entsprechend erklären. Und meine Erfahrung ist, dass das durchaus auch verstanden wird.
Die Beratungen im Parlament zur neuen Botschaft über die internationale Zusammenarbeit (IZA) der nächsten vier Jahre sind abgeschlossen. Wie haben Sie die Debatte erlebt?
Die Coronakrise hat die IZA nicht in Frage gestellt, unser Budget für 2020 wurde sogar noch leicht erhöht. Es freut mich, dass die Einsicht so klar war, dass in einer schwierigen Zeit bestehende Systeme gestärkt und nicht durch Einsparungen geschwächt werden sollen. Die Diskussionen im Parlament waren inhaltlich spannend, für mich war es ein gutes Zeichen, dass ParlamentarierInnen wirklich verstehen wollen, was auf dem Spiel steht.
Die Bedürfnisse sind aufgrund der Coronakrise stark angestiegen. Wäre es nicht endlich Zeit, dass die Schweiz ihre Entwicklungsausgaben auf den internationalen Zielwert einer APD-Quote von 0.7% des Nationaleinkommens erhöht?
Klar würde ich es persönlich begrüssen, wenn wir mehr Geld für unsere wichtige Arbeit zur Verfügung hätten. Aber ich finde, eine starre Quote ist – gerade heutzutage – auch problematisch, je nach Wirtschaftsgang führten die laufenden Anpassungen zu starken Schwankungen beim tatsächlich zur Verfügung stehenden Budget. In Grossbritannien etwa führt das zu grossen Unsicherheiten in der Planung mit den Partnerländern. In der Schweiz gehen wir von mehr oder weniger stabilen Beiträgen für die EZA aus. Mir ist es lieber, mit festen Geldbeträgen als mit Prozentsätzen zu planen.
Wie wird die Pandemie die Arbeit der DEZA beeinflussen oder verändern?
Wir wollen dort, wo wir jetzt engagiert sind, möglichst präsent bleiben. Und dies nicht zuletzt darum, weil sich andere Länder mit grösseren Budgets wegen der Pandemie zurückziehen. Das wird den Erwartungsdruck auf uns erhöhen. Wir gehen davon aus, dass gerade Länder, in denen in den letzten Jahren eine Mittelklasse entstanden ist, durch die Pandemie starke Rückschläge erleiden werden. Neu geschaffene Arbeitsplätze gehen wieder verloren, viele Menschen werden in den verletzlichen informellen Sektor zurückgeworfen. Wir werden sicher nicht weniger Arbeit haben, im Gegenteil. Dabei wollen wir möglichst nahe bei den von der Krise betroffenen Menschen sein; es reicht nicht, im Büro in Bamako, Bischkek oder Addis Abeba zu sein, um die Bedürfnisse der Leute wirklich zu kennen.
Alliance Sud kritisiert den geplanten Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Privatsektor in der neuen IZA-Botschaft. Können Sie zum jetzigen Zeitpunkt mehr dazu sagen, nach welcher Strategie das geschehen soll?
Das ist ein Thema, das mich sehr interessiert und beschäftigt, auch DEZA-intern spüre ich ein zunehmendes Interesse. Wir arbeiten auf Hochtouren daran zu präzisieren, wie diese Zusammenarbeit mit dem Privatsektor konkret aussehen soll. Im Zentrum steht dabei die Wirkung, die wir erzielen wollen. Wie lassen sich staatliche und Mittel aus der Wirtschaft so kombinieren, dass die Bevölkerungen vor Ort eindeutig davon profitieren? Wie bringen wir grössere und auch mittelgrosse Firmen – auch solche aus dem Süden – dazu, Arbeitsplätze in Ländern zu schaffen, in denen das wirtschaftliche Umfeld dafür nicht ideal ist? Und wie kann dies realisiert werden, ohne bestehende lokale Strukturen zu schädigen? Wir haben im Sommer Leitlinien entwickelt, die diese Risiken ernst nehmen und definieren, unter welchen Bedingungen wir uns eine Zusammenarbeit mit dem Privatsektor vorstellen können. Oder eben nicht. Diese Unterlagen sind zurzeit beim Departementschef, bis Ende Jahr werden wir informieren, wie es diesbezüglich weitergeht.
Grosse Konzerne sind nicht gerade bekannt für die von Ihnen postulierte Transparenz...
Kein Geheimnis ist, dass der Privatsektor primär Profit machen will. Wenn wir mit dem Privatsektor zusammenarbeiten, dann mit dem gemeinsamen Ziel, die nachhaltige Entwicklung zu fördern. Wie können wir sicherstellen, dass gewisse Teile der Bevölkerung nicht durch die Maschen fallen? Diese Diskussionen sind nicht einfach zu führen; ich habe aber den Eindruck, dass die Bereitschaft des Privatsektors, soziale und ökologische Aspekte in einer langfristigen Perspektive zu berücksichtigen, gewachsen ist.
Verstehen Sie persönlich die Befürchtung, dass mit dieser Strategie die Bedürfnisse der ärmsten Bevölkerungsschichten oder die Stärkung der Zivilgesellschaft im Süden vernachlässigt werden könnte?
Ja, ich kann diese Befürchtungen nachvollziehen. Aber ich kenne auch den dringenden Wunsch der armen Länder und der verletzlichsten Schichten nach mehr sicheren Arbeitsplätzen. Und die sind ohne Einbezug – auch des finanzkräftigen – Privatsektors kaum zu schaffen. Darüber hinaus: Wenn es uns gelingt, durch Dialog oder Partnerschaften mit dem Privatsektor zur Verbesserung von sozialen oder ökologischen Standards und Geschäftspraktiken beizutragen, dann ist einiges gewonnen. Ohne diesen Dialog verpassen wir die Chance, wirklich etwas bewegen zu können.
Mehr IZA-Gelder sollen auch in die internationale Klimafinanzierung fliessen – obwohl das Pariser Klimaabkommen dafür neue und zusätzliche Gelder verlangt. Eine Studie von Alliance Sud zeigt, dass Klimafinanzierung bisher vor allem in Länder mittleren Einkommens eingesetzt wurde. So bleibt doch immer weniger Gelder für die Armutsreduktion übrig?
Es wäre sicher nicht falsch, wenn wir zusätzliche Gelder für die Klimafinanzierung hätten. Tatsache ist, dass wir mit unseren Mitteln in den Ländern mittleren Einkommens für den Klimaschutz oft am meisten Wirkung erzielen können, dort wo notabene die Ungleichheit häufig sehr gross ist. Wir müssen allerdings noch besser sicherstellen, dass wir dort auch die am stärksten von der Klimaveränderung Betroffenen – das sind vielfach die Ärmsten – erreichen.
Mir ist völlig klar, wie dramatisch sich die Verhältnisse wegen der Klimaveränderung in kürzester Zeit verändert haben. Letztes Jahr traf ich in Somalia vertriebene Viehzüchter, die rund um einen Brunnen Getreide anbauten, wofür sie Saatgut erhalten hatten. Sie wünschten sich aber wieder Ziegen und Kamele, obwohl sie wussten, dass diese vielleicht keine fünf Jahre mehr überleben würden. Wenn ganze Bevölkerungen ihre Lebensweise neu ausrichten müssen, dann ist das eine enorme Herausforderung für sie – aber auch für uns und unsere Arbeit.
Wie kommen Sie persönlich mit diesen fast unlösbaren Aufgaben zurecht?
Bescheidenheit und Demut sind wichtig. Wir haben Expertise, aber keine fertigen Lösungen, weder die DEZA noch andere Entwicklungsagenturen. Darum braucht es auch die multilaterale Zusammenarbeit so dringend, damit man die enormen Probleme gemeinsam multiperspektivisch angehen und gemeinsam eine Vision erarbeiten kann. Dabei gibt es keine einfachen Lösungen mehr. Wichtig ist für mich, dass man sich immer vor Ort mit den Betroffenen über ihre Bedürfnisse auseinandersetzt.
Alliance Sud verlangt von der Schweizer Politik mehr Kohärenz bei der Lösung dieser enormen Probleme. Dazu gehört nicht nur die Entwicklungs-, sondern zum Beispiel auch die Steuer- und die Handelspolitik. Wie sehen Sie das?
In diesem Bereich bleibt einiges zu tun, wie Konsultationen zur IZA-Strategie gezeigt haben. Ich denke, es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Zivilgesellschaft, auf diese Zusammenhänge hinzuweisen. Die Aufgabe der DEZA ist es primär, die Kohärenz unserer eigenen Strategie zu garantieren. Und im Austausch und Dialog mit anderen Bundesämtern immer wieder auf das wichtige Thema Politikkohärenz hinzuweisen.
Patricia Danzi
Patricia Danzi (51) ist als Tochter einer Schweizerin und eines Nigerianers im Kanton Zug aufgewachsen. Sie hat Geografie sowie Agrar- und Umweltwissenschaften studiert und arbeitete seit 1996 beim IKRK, wo sie die letzten fünf Jahre die Regionaldirektion Afrika leitete.
Artikel teilen
Meinung
Nicht aufgeben lohnt sich
05.10.2020, Internationale Zusammenarbeit
2019 berichtete «global» über die Schweizer Agrarfirma GADCO in Ghana. Die Verantwortlichen wehrten sich gegen die Darstellung. Gastautor Holy Kofi Ahiabu, der ghanaische Mitarbeiter von Alliance Suds Kristina Lanz wurde eingeschüchtert.

Holy Kofi Ahiabu
von Holy Kofi Ahiabu
Seit 2014 arbeitete ich mit an mehreren von Kristina Lanz durchgeführten Studien über die Auswirkungen des GADCO-Landerwerbs auf Dörfern in der Volta-Region ganz im Süden Ghanas. Die Ergebnisse unserer Arbeit wurden mit den DorfbewohnerInnen sowie FirmenvertreterInnen und VertreterInnen der lokalen Autoritäten mehrmals an öffentlichen Versammlungen diskutiert. Die Menschen beklagten sich unter anderem, dass ihnen GADCO ihr Ackerland ohne angemessene Entschädigungen abgeluchst habe, dass Fischteiche und Trinkwasserquellen zerstört, der Zugang zu Brennholz erschwert worden seien, dass Zufahrtswege blockiert und die Landbevölkerung schikaniert wurde, die gegen den Verlust ihres Farmlands protestierte.
Unser Ziel war es immer, Lösungen für die Probleme zu finden, die unsere Forschung aufgedeckt hat. Auch nach Abschluss der Forschungsarbeiten besuchte ich die Gemeinden häufig, um zu sehen und zu hören, wie sich die Dinge verändert haben – leider meist zum Schlechten. Zusammen mit einer Kollegin von Brot für alle nahm Kristina Lanz schliesslich Kontakt mit dem Schweizer Eigentümer von GADCO auf. Viele der Probleme sind kurz- bis mittelfristig nicht zu lösen; also beschlossen wir, vom GADCO-CEO den Bau einer Brücke über den von der Firma gebauten Kanal zu fordern. Ohne eine solche Brücke bliebe das Dorf Kpevikpo von seinen Nachbargemeinden abgeschnitten. Wenn der Kanal Wasser führte, konnten Kinder nicht mehr zur Schule, Frauen nicht mehr zum Markt gehen, die Menschen hatten keinen Zugang mehr zu sozialen Diensten oder konnten nicht an Versammlungen teilnehmen.
Schliesslich erklärte sich der GADCO-CEO bereit, an einem von mir organisierten Gemeindetreffen in Kpevikpo teilzunehmen. Er sollte mich am besagten Tag in der naheliegenden Stadt Sogakofe abholen, damit ich ihn zu dem Treffen führen konnte. Anstatt nach Kpevikpo wurden wir jedoch zum GADCO-Büro gefahren. Zu meiner Überraschung warteten dort mehrere Vertreter der traditionellen Dorfautoritäten, die mit GADCO gemeinsame Sache gemacht hatten; ich wurde als Drahtzieher von Kristina Lanz‘ «global»-Artikel beschimpft und wegen meiner Teilnahme an den Forschungen verunglimpft. Kristina ihrerseits erhielt einen Brief von den Chiefs, in dem unsere Forschung diskreditiert und uns beiden mit rechtlichen Schritten gedroht wurde.
Nach dem Treffen ging es zusammen mit den Chiefs doch noch zum Gemeindetreffen, wo der GADCO-CEO schliesslich dem Bau der Brücke zustimmte und versprach, jeden Haushalt in Kpevikpo mit Solarpanels zu versorgen. Als Verfechter der nachhaltigen Gemeindeentwicklung wollte ich seither sicherstellen, dass es nicht nur bei Versprechen blieb. Nach vielen Mails und einigem Hin und Her war es im Juli 2020 tatsächlich soweit: Die Brücke wurde gebaut (Bild). Auf die versprochenen Solarpanels warten die Leute allerdings immer noch.
Mein oberstes Ziel bleibt es, für positive Veränderungen einzustehen. Dafür werde ich mich weiterhin einsetzen, auch wenn dies nicht immer einfach ist, da ich dem Risiko von Einschüchterungen ausgesetzt bin und als Einzelperson, die nicht mit einer Organisation verbunden ist, dafür – abgesehen von der temporären Unterstützung aus der Schweiz – auch nicht bezahlt werde.
Der Autor, Holy Kofi Ahiabu ist Forschungsassistent und verteidigt eine nachhaltige Gemeindeentwicklung in Sogakofe, Region Volta, Ghana
Artikel teilen
Artikel
Was bedeutet eigentlich «Nachhaltigkeit»?
09.12.2020, Internationale Zusammenarbeit
Überlegungen zu einem inflationär verwendeten Begriff, dessen Ansprüche auch in der Wissenschaft umstritten sind. Ein Paradigmenwechsel tut not.

Das Wort „Nachhaltigkeit“ ist in aller Munde – wir kaufen „nachhaltig“ ein, wir reisen „nachhaltig“, Firmen preisen ihre „nachhaltigen“ Strategien, ja sogar der Finanzplatz will „nachhaltig“ werden. Glencore, Nestlé, Credit Suisse oder die UBS – auf jeder Website findet sich heutzutage eine mehr oder weniger ausführliche Dokumentation zum Thema. So viele verschiedene Akteure die Nachhaltigkeit für sich und ihre Aktivitäten beanspruchen, so unterschiedlich deren Ansätze und Definitionen, was Nachhaltigkeit eigentlich konkret bedeutet. Häufig geht es darum, wirtschaftliche Profit- und Wachstumskriterien mit ökologischen Kriterien zu verbinden, d.h. mit einem möglichst klima-, umwelt- und ressourcenschonenden Produktions- und/oder Konsumansatz. Andere Akteure ergänzen diesen Ansatz noch mit sozialen Ansprüchen (etwa gut bezahlte und menschenwürdige Arbeitsplätze, Geschlechtergerechtigkeit etc.). Seitdem die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) der UNO existieren, werden zudem auch immer häufiger einzelne der 17 Ziele herausgepickt, um nachhaltiges Engagement zu demonstrieren.
Eine erste offizielle Definition von „nachhaltiger Entwicklung“ findet sich im Brundtland Report von 1987. Sie bezeichnet eine "Entwicklung, welche die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“. Die Vernetztheit aller wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Vorgänge wird in diesem Bericht erstmals betont. So wird denn Nachhaltigkeit oft als 3-Säulen-Modell dargestellt – alternativ als drei miteinander verbunden Kreise –, wobei Nachhaltigkeit erreicht sein soll, wenn alle drei Säulen unter einem Dach zusammenkommen bzw. die Kreise eine grosse Schnittmenge aufweisen.
Aber wie genau stehen diese drei Dimensionen zueinander? Ist es möglich, alle Dimensionen gleichwertig zu behandeln? Und in welcher Beziehung steht das Wirtschaftswachstum zur Nachhaltigkeit?
Schwache und starke Nachhaltigkeit
Diese Fragen spalten auch die Wissenschaft. Die grössten Differenzen innerhalb der wissenschaftlichen Debatte lassen sich exemplarisch aufzeigen zwischen Proponenten der sogenannten „schwachen Nachhaltigkeit“ (weak sustainability) und jenen der „starken Nachhaltigkeit“ (strong sustainability). Beide Lager gehen davon aus, dass sich das menschliche Wohlergehen aus verschiedenen Kapitalien zusammensetzt:
- "Menschengemachtem Kapital“ (Infrastruktur, Gebäude, Maschinen etc.)
- „Natürlichem Kapital“, welches sowohl für den Produktionsprozess relevante Ressourcen (u.a. Holz, Wasser, Mineralien), wie auch für das Leben an sich relevante Ressourcen (Biodiversität, Atmosphäre, Ökosysteme etc.) umfasst
- Humankapital (Bildung, Gesundheit etc.)
- Sozialkapital (z.B. menschliche Beziehungen, Werte)
- Finanzkapital
Beide Lager sehen Nachhaltigkeit dann als gegeben, wenn die Summe der Kapitalien entweder beibehalten oder vergrössert wird, so dass das Wohlergehen der zukünftigen Generationen nicht gefährdet wird. BefürworterInnen der „schwachen Nachhaltigkeit“ gehen jedoch davon aus, dass die verschiedenen Arten von Kapital untereinander austauschbar sind und nur die Summe der Kapitalien gleichbleiben oder wachsen muss, nicht aber jede einzelne Art von Kapital. Aus ihrer Sicht heisst das konkret: Wenn z.B. natürliches Kapital dazu genutzt wird, um es in menschengemachtes Kapital zu transformieren und dieses zu vergrössern, ist ein System bereits nachhaltig. Dem Problem der voranschreitenden Ressourcenknappheit und Umweltdegradation stellen sie den technischen Fortschritt entgegen (welcher notabene durch die Umwandlung von natürlichem Kapital in menschengemachtes Kapital stattfindet). Die Vertreter dieser Auffassung von Nachhaltigkeit, die in politischen und wirtschaftlichen Kreisen nach wie vor weit verbreitet ist, gehen davon aus, dass Wirtschaftswachstum eine notwendige Voraussetzung für menschliches Wohlergehen und Wohlstand ist und dass der damit einhergehende technische Fortschritt zur Lösung ökologischer Probleme genutzt werden kann.
BefürworterInnen der „starken Nachhaltigkeit“ argumentieren hingegen, dass Naturkapital nicht einfach durch andere Kapitalien ersetzbar ist. Sie zeigen die planetaren Grenzen sowie die geo- und biophysischen Kipppunkte (tipping points) auf, welche – sobald sie überschritten werden – irreversible Vorgänge auslösen können, die bestimmte Spezies oder das gesamte Leben auf der Erde gefährden (Beispiele dieser Kipppunkte sind etwa das Schmelzen des antarktischen Eises oder die Zerstörung des Amazonasgebietes). Proponenten dieses Nachhaltigkeitsmodells argumentieren mit den planetaren Grenzen des Wachstums und plädieren für eine Kontextualisierung der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, welche unsere Abhängigkeit von unserer natürlichen Umwelt klarer aufzeigt. Sie bevorzugen daher eine andere Darstellung von Nachhaltigkeit (siehe Abbildung unten), um zu illustrieren, dass die drei Dimensionen nicht unabhängig voneinander existieren, sondern dass wir als Gesellschaft ein Teil unserer natürlichen Umwelt sind. Auch die Wirtschaft existiert nicht unabhängig von Gesellschaft und Umwelt, sondern ist Bestandteil des sozialen Lebens auf dem Planeten und wird von der Gesellschaft gestaltet.
Nachhaltige Entwicklung – ein Widerspruch?
Verschiedene VertreterInnen der „starken Nachhaltigkeit“ (etwa der Deep Ecology und Ecological Economics) lehnen die Idee der „nachhaltigen Entwicklung“ grundsätzlich ab, da Nachhaltigkeit und Entwicklung – ein Wort, das oft mit Wirtschaftswachstum gleichgesetzt wird – aus ihrer Sicht zwei miteinander unvereinbare Konzepte sind. Sie betonen, dass die politische Debatte rund um die „nachhaltige Entwicklung“ (inklusive die Agenda 2030) bisher hauptsächlich für kosmetische Reformen des bestehenden Wirtschaftssystems genutzt wurde, ohne dabei die unterliegende Problematik von ungleicher Machtverteilung, von Ausbeutung und Redistribution anzusprechen. Sie monieren auch, dass unser wachstumsorientiertes ökonomisches System massiv abhängig ist von der Ausbeutung natürlicher und menschlicher Ressourcen (Arbeitskräften), was dazu geführt hat, dass sowohl die sozialen Ungleichheiten wie auch die Umweltzerstörung einen Punkt erreicht haben, der das menschliche Überleben auf dem Planeten gefährdet. Verschiedene feministische WissenschaftlerInnen (etwa aus dem Gebiet der Feministischen Ökonomie oder der Feministischen Politischen Ökologie) fügen dem noch hinzu, dass die allumfassende Logik des Wirtschaftswachstums nicht nur zu wachsenden sozialen Ungleichheiten und Umweltschäden führt, sondern dass auch die Fürsorge- und Pflegearbeit, welche einen Grundpfeiler des menschlichen Überlebens darstellt (und nach wie vor grösstenteils von Frauen ausgeführt wird), immer mehr unter Druck kommt, da auch sie der vorherrschenden Wirtschafts- und Profitlogik untergeordnet wird. Schliesslich kommt auch aus dem Süden Kritik am Modell der „nachhaltigen Entwicklung“, dies aufgrund seiner westlich geprägten linearen Auffassung von Fortschritt und Wohlstand sowie fehlender Naturverbundenheit und Spiritualität (alternative Modelle sind etwa das bolivianische Konzept des buen vivir oder das indische swaraj). So plädieren denn auch verschiedene Kritiker für einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel, welcher die Umwelt, die Fürsorge (Care) und die zwischenmenschlichen Beziehungen ins Zentrum stellt und die Wirtschaft anhand entsprechender Ziele neu definiert und reguliert.
Ein Paradigmenwechsel ist unabdingbar
Auch wenn das Konzept der „nachhaltigen Entwicklung“ vage und z. T. strittig bleibt, gehören aus Sicht von Alliance Sud sowohl der damalige Brundtland Report wie auch die Agenda 2030 zu den wichtigsten Grundpfeilern der Geschichte der „Nachhaltigkeit“. Allerdings ist die Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben: Es reicht nicht aus, sich zu Nachhaltigkeit zu bekennen und dazu einzelne SDGs als Kronzeugen heranzuziehen. Notwendig ist eine Diskussion über die der „nachhaltigen Entwicklung“ zugrundeliegenden Visionen. Alliance Sud positioniert sich dabei klar auf Seite der VertreterInnen der „starken Nachhaltigkeit“, welche die Wirtschaft so gestalten möchten, dass sie einen Beitrag zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit leistet. Wirtschaftliche Tätigkeit ist eine Voraussetzung für Bedürfnisbefriedigung, technische Innovation und Wohlstand; allerdings ist unser dereguliertes, wachstums- und profitorientiertes Wirtschaftssystem gleichzeitig ursächlich verantwortlich für einen Grossteil der Probleme, welche die SDGs beseitigen sollen (Ausbeutung, Ungleichheit, Verlust der Biodiversität, Treibhausgase, Verschmutzung der Meere, gesundheitliche Probleme etc.). Es scheint daher höchst unwahrscheinlich, dass die Ziele der Agenda 2030 erreicht werden, ohne die Ursache der Probleme anzugehen. Um die SDGs zu erreichen und die Welt gerechter und lebenswerter zu gestalten, müssen wirtschaftliche Tätigkeiten und Investitionen so reguliert werden, dass ökologisches und soziales Verhalten belohnt und umweltzerstörerisches und menschenfeindliches Verhalten sanktioniert werden. Gleichzeitig braucht es – um noch einmal die ökonomische Sprache der Kapitalien zu nutzen – eine Umverteilung des globalen Finanzkapitals, welches in den letzten Jahrzehnten massiv angewachsen ist, allerdings ohne dabei gleichzeitig zu einem dementsprechenden Anstieg der anderen Kapitalien geführt zu haben. Finanzkapital erzielt jedoch erst dann eine Steigerung des menschlichen Wohlergehens, wenn es in die anderen Kapitalien investiert wird; dies wiederum geschieht in einem primär profitorientierten Wirtschaftssystem nur wenn eine Investition profitabel ist bzw. das Finanzkapital des Investors weiter anwachsen lässt.
Während sich die momentane entwicklungspolitische Debatte aus diesem Grund darum dreht, wie man staatliche Gelder am besten dazu nutzen kann, möglichst viele private Investitionen für „nachhaltige“ Projekte zu mobilisieren – indem ihre Rentabilität gesteigert resp. ihre Risiken minimiert werden – steht eine aus Sicht von Alliance Sud viel wichtigere grundsätzliche und ehrliche Debatte noch aus. Eine Debatte zu den Ursachen und Auswirkungen der massiven globalen Ungleichheit (inklusive der Konzentration des globalen Finanzkapitals in den Händen einiger weniger) sowie zu den Möglichkeiten der Erreichung der SDGs durch Umverteilung und Regulierung des Finanzkapitals (etwa in Form von gerechter Besteuerung). Zudem scheint ein Paradigmenwechsel hin zu mehr Menschlichkeit und Naturverbundenheit, globaler Kooperation und Solidarität unabdingbar, wenn wir die Welt den nächsten Generationen in einem lebenswerten Zustand überlassen wollen. Viel Zeit haben wir nicht mehr.
Artikel teilen
Meinung
Corona-Nebenwirkungen treffen nicht alle gleich
10.12.2020, Internationale Zusammenarbeit
In Nigeria stieg während der coronabedingten Abriegelung die Gewalt gegen Frauen und Mädchen. UN Women hat diese weltweit beobachtete Tatsache als «Schattenpandemie» bezeichnet.

von Oladosu Adenike Titilope
Das nachhaltige Entwicklungsziel Nummer 5 will die Gleichstellung der Geschlechter erreichen. Wie überall stellen auch in Nigeria Frauen und Mädchen die Hälfte der Bevölkerung und damit die Hälfte des Entwicklungspotenzials dar. Doch die Ungleichheit der Geschlechter im Land ist omnipräsent und behindert den sozialen Fortschritt und die Entwicklung. Zwar verliehen die Millenniumsentwicklungsziele der Einschulung von Kindern auf der Primarstufe einen enormen Schub, doch in der Sekundarstufe bleiben die Mädchen bis heute weit hinter den Knaben zurück. Vor allem in den Dörfern auf dem Land bleiben Mädchen aus armen Familien stark benachteiligt.
Es ist unbestritten, dass der gleichberechtigte Zugang von Frauen und Mädchen zu Bildung, Gesundheitsfürsorge, menschenwürdiger Arbeit und ihre Vertretung in politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen die Voraussetzung für die nachhaltige Entwicklung einer Gesellschaft sind. SDG 5 («Gender Equality») ist zwar ein eigenständiges Ziel, doch auch die anderen Ziele können nur erreicht werden, wenn den Bedürfnissen von Frauen dieselbe Aufmerksamkeit geschenkt wird wie denen von Männern. Im Jahr 2000 unternahm Nigeria den mutigen Schritt, die nationale Frauenpolitik an der globalen Konvention über alle Formen der Diskriminierung von Frauen (CEDAW) auszurichten und dies gesetzlich zu verankern. Das Land formulierte Politiken und Programme, die darauf abzielen, die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern im sozioökonomischen und politischen Bereich zu verringern. Diese Politik ist jedoch zur Farce verkommen. So waren die nigerianischen Frauen während des Corona-Lockdowns mit einer doppelten Pandemie konfrontiert: Zu den wirtschaftlichen Folgen hatten sie einen sprunghaften Anstieg geschlechtsspezifischer Gewalt zu ertragen. Wie die Frauen über alle Kontinente und Kulturen hinweg fordern Nigerianerinnen das Recht, ihr Leben frei von Gewalt, in Frieden und Würde zu leben.
Zusätzliche Gewalt im Lockdown
Neuere Studien zeigen einen direkten Zusammenhang zwischen dem Schutz der Frauenrechte und der sozialen Entwicklung. Die Zunahme geschlechtsspezifischer Gewalt während der Abriegelungen hat die UNO als «Schattenpandemie» bezeichnet, die das Leben und die Existenzgrundlagen von Frauen und Mädchen bedroht. Für Nigeria weisen aktuelle Untersuchungen jedoch darauf hin, dass diese Krise schon lange schwelt. Nicht weniger als 30% der Mädchen und Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren haben sexuellen Missbrauch erlebt. Mangelnde Koordination zwischen den verschiedenen Stellen, welche die geschlechterdiskriminierenden Normen der Regierung durchsetzen sollten, behindern eine effektive Bekämpfung geschlechterbezogener Gewalt. Die Covid-19-Pandemie hat das bloss noch akzentuiert. Die ForscherInnen Jessica Young und Camron Adib schreiben in einem gemeinsamen Beitrag, dass die Pandemie zu einer Verlagerung von Prioritäten und Ressourcen geführt und eine Welle von Berichten über geschlechtsspezifische Gewalt ausgelöst habe; dies nachdem die Regierung Lockdowns über Lagos – den bevölkerungsreichsten Wirtschaftsraum Afrikas –, den Hauptstadtbezirk und den Bundesstaat Ogun verhängt hatte.
Aus den Daten der beiden AutorInnen zeigte sich, dass die Berichte über geschlechtsspezifische Gewalt nach der Verfügung des Lockdowns Ende März in 23 von 36 nigerianischen Bundesstaaten um 149% angestiegen sind. Während in den drei Bundesstaaten Federal Capital Territory, Lagos und Ogun die Zahl der Fälle von 60 im März auf 238 im April anstieg, was einem Anstieg von 297% entspricht, betrug der Anstieg in den Bundesstaaten Benue, Ebonyi und Cross River nur 53%. Dort hatten die jeweiligen Kommunalverwaltungen weniger strikte Sperren verfügt.
Schwieriger Zugang zur Justiz für Opfer
Darüber hinaus hatte der Lockdown die Schliessung von Notunterkünften zur Folge, was den Zugang zu lebensrettenden Diensten aber auch zur Justiz massiv erschwert; also just in einer Zeit als diese am dringendsten benötigt wurden. Generell ist zu beobachten, dass der Zugang zur Justiz, zu Rechtsschutz und Wiedergutmachung für Opfer immer schwieriger wird. Untersuchungen aus früheren Gesundheitskrisen wie der Ebolakrise in Westafrika haben gezeigt, dass der Verlust der Lebensgrundlagen darüber hinaus die Gefahr birgt, dass Frauen in die Prostitution gezwungen werden. Weil in Nigeria über 80% der erwerbstätigen Frauen im informellen Sektor mit wenig oder gar keinem sozialen Schutz und Sicherheitsnetz beschäftigt sind, ist diese Gefahr während der Coronakrise speziell ausgeprägt.
In Nigeria sind zudem 18 Millionen Schülerinnen von Schulschliessungen betroffen. Die Schliessung der Schulen setzt heranwachsende Mädchen auch einem erhöhten Risiko von Kinderheirat und Teenagerschwangerschaften aus. Frühe Eheschliessungen sind an sich bereits weit verbreitet, denn 44% der Mädchen heiraten in Nigeria bevor sie 18jährig sind. In Nordnigeria, wo die Tradition der Bildung der Mädchen zusätzlich Steine in den Weg legt, haben arme Familien ihre Töchter während der Pandemie gezwungen zu heiraten, um entsprechende Brautgelder und Geschenke zu erhalten. Schon vor Covid-19 hatte Nigeria weltweit die dritthöchste absolute Zahl von Kinderbräuten; dieses Problem droht sich noch weiter zu verschärfen.
Hindernisse beseitigen, Bedürfnisse abdecken
Die Herausforderungen, die das Coronavirus für Frauen darstellt, erfordert Engagement und Vertrauen. Die Bildung muss sich auf ganzheitlichere Massnahmen stützen, die über den Zugang zur Bildung hinausgehen und auch andere Hindernisse angehen, denen Mädchen und junge Frauen beim Zugang zu grundlegenden sozialen Dienstleistungen begegnen. Hierfür muss die nigerianische Regierung für die Zeit nach der Pandemie strategische Pläne entwickeln. Die Abriegelungen haben gezeigt, dass die Regierung landesweit in die Computerinfrastruktur der Schulen investieren muss, um den Unterricht in Krisenzeiten zu garantieren; es braucht Pläne für ein Krisenmanagement und die Bereitstellung der dafür nötigen Gelder. Ministerien und Agenturen sollten nach Geschlechtern getrennte Daten erheben, um zu erfahren, wie die Schülerinnen und Schüler von den Schulschliessungen betroffen wurden. In allen 777 Bezirken Nigerias soll den Opfern von sexuellem Missbrauch Gerechtigkeit widerfahren; dafür müssen die auf Genderfragen spezialisierten Abteilungen der Behörden ausgebaut werden.
In der Nach-Coronazeit muss die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen gefördert werden, denn es sind die Frauen, die das Leben ihrer Familien und der Haushalte organisieren. Lobenswerte Regierungsprogramme zur Finanzierung der Händler- und Bauern müssen mit geschlechtsspezifischen Projekten für Mädchen und Frauen gestärkt werden. In einer Welt, die von Covid-19 hart getroffen worden ist, sind konkrete Politiken gegen die tödlichen Auswirkungen des Virus auf die Wirtschaft und die Frauen dringend notwendig.
Artikel teilen
Medienmitteilung
Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz: Quo vadis?
02.05.2019, Internationale Zusammenarbeit
Der Bundesrat hat seinen Vorschlag, wie er die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit zukünftig ausrichten will, in eine Vernehmlassung geschickt. Alliance Sud reagiert darauf mit einem eigenen Positionspapier.

von Eva Schmassmann, ehemalige Fachverantwortliche «Politik der Entwicklungszusammenarbeit»
Heute hat der Bundesrat seinen Entwurf der Botschaft über die internationale Zusammenarbeit für die Periode 2021-2024 veröffentlicht und lädt interessierte Kreise ein, sich im Rahmen einer fakultativen Vernehmlassung dazu zu äussern. Alliance Sud, die entwicklungspolitische Denkfabrik der wichtigsten Schweizer Entwicklungsorganisationen, nimmt diese Einladung gerne an und wird ihre Kommentare, Fragen und konstruktive Kritik sowie die Antworten auf die konkreten Fragen der Vernehmlassung nach gründlicher Analyse des vorliegenden Entwurfs auch öffentlich kommunizieren.
In einem eigenen Positionspapier hat Alliance Sud ihre Forderungen an die zukünftige Entwicklungszusammenarbeit zusammengefasst. So muss sich diese zwingend an ihrem verfassungsmässigen Grundauftrag orientieren und insbesondere Not und Armut in den ärmsten Ländern lindern. Sie muss sich in Programmen und Projekten sowie im Politikdialog dafür einsetzen, dass die Zivilgesellschaft gestärkt wird. Insbesondere in Ländern mit autoritären Regimes trägt sie dadurch zum Aufbau eines zivilgesellschaftlichen Gegengewichts bei, das zu inklusiveren politischen Entscheidungsprozessen beitragen kann. Dafür muss die Schweiz ihrer Entwicklungszusammenarbeit ausreichend Mittel zur Verfügung stellen; die im Botschaftsentwurf in Aussicht gestellten 0.45% des Bruttonationaleinkommens (BNE) sind weit entfernt vom festgelegten Ziel, 0.7% des BNE für die Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden. Und dies, obwohl der Bund Jahr für Jahr Milliardenüberschüsse ausweist.
Ausserdem sieht die Botschaft eine Erhöhung der Beiträge zur internationalen Klimafinanzierung vor sowie zusätzliche Gelder für Migrationsprojekte. Für die öffentliche Klimafinanzierung muss die Schweiz zusätzliche und verursachergerechte Quellen schaffen. Gelder für Projekte im Migrationsbereich begrüsst Alliance Sud dann, wenn Programme und Projekte der Verbesserung der Grundversorgung im Gesundheits- und Bildungswesen dienen, die ländliche Entwicklung begünstigen oder die gute Regierungsführung vorantreiben. Welche Form von Migrationsprojekten der Bundesrat vorsieht, wird Alliance Sud einer genauen Prüfung unterziehen.
Damit die Entwicklungszusammenarbeit ihre Wirkung entfalten kann und nachhaltige Entwicklungsprozesse in Gang kommen, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Denn die Wirkung der Entwicklungszusammenarbeit darf nicht isoliert von anderen politischen Handlungsfeldern betrachtet werden. Konkret heisst dies, dass alle Departemente eine Mitverantwortung für die Wirkung der Entwicklungszusammenarbeit tragen; das gilt namentlich für Entscheide zur Ausgestaltung der Steuerpolitik, der Handelspolitik oder der Sicherheitspolitik. Im Sinne der Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung müssen alle politischen Geschäfte, die Auswirkungen auf Entwicklungsländer haben, entwicklungsfördernd ausgestaltet werden.
Download-Link:
«Die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz: Die Position von Alliance Sud»,
Ende April 2019.
Artikel teilen
Medienmitteilung
Die Agenda 2030 ins Zentrum rücken
20.08.2019, Internationale Zusammenarbeit, Agenda 2030
Alliance Sud, die Denkfabrik der Schweizer Entwicklungsorganisationen, kritisiert in ihrer Vernehmlassung die Pläne des EDA und des WBF zur Neuausrichtung der Internationalen Zusammenarbeit (IZA) 2021-24. Die Ziele der IZA sollten konsequent an der Agenda 2030 der UNO ausgerichtet werden.

Das Aussendepartement (EDA) und das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) stellen drei Kriterien – Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung, Interessen der Schweiz und Mehrwert der Schweizer IZA – ins Zentrum ihres IZA-Berichts, lassen dabei aber die zentrale Frage offen: Welche Art von Entwicklung will die Schweiz fördern? Für Alliance Sud ist klar, dass sich die IZA an der Uno-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung orientieren muss; die Schweizer Politik soll generell und konsequent unter das Leitprinzip der Transformation von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in Richtung soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit gestellt werden. Die Ziele und Schwerpunkte der IZA-Botschaft müssen dringend in diesem Sinn ergänzt werden.
Transformationsprozesse setzen ein gesamtheitliches Verständnis von Politik voraus. Damit nachhaltige Entwicklung kein leeres Schlagwort bleibt, muss die Schweizer Politik ihre Kohärenz über alle Departemente hinweg verbessern, wie das auch der OECD-Entwicklungsausschuss DAC von der Schweiz fordert.[1] Besonders in der Pflicht stehen hier die Handelspolitik und die Steuer- und Finanzpolitik der Schweiz. Die Botschaft zur IZA 2021-2024 sollte diese Politikfelder und die notwendigen Anstrengungen explizit benennen.
Aus Sicht von Alliance Sud sind die im erläuternden Bericht zur IZA vorgesehenen Mittel klar ungenügend: Mit dem vorgesehenen Finanzrahmen kann die Schweiz ihren internationalen Verpflichtungen nicht nachkommen. Für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (aide publique au développement, APD) wird für 2021-2024 eine Quote von 0.45% des Bruttonationaleinkommens (BNE) anvisiert. Zieht man davon die Asylkosten im Inland ab, sind es sogar nur 0.40%. Dieses Ziel widerspricht dem international wiederholt gegebenen Versprechen, die APD-Quote auf 0.7% des BNE zu erhöhen. Das ist umso stossender als der Bund in seiner Rechnung seit 2015 wiederholt Milliardenüberschüsse ausweist, im Durchschnitt waren es 2.7 Milliarden CHF pro Jahr. Da auch für das laufende Jahr mit einem Überschuss von 2.8 Milliarden CHF gerechnet wird, ist eine schrittweise Erhöhung der APD auf 0.7% des BNE überfällig.
Zu den im Vernehmlassungsverfahren gestellten Fragen – sind die vorgeschlagenen Ziele, die gesetzten Schwerpunkte und die geografische Fokussierung der IZA richtig? – sagt Alliance Sud drei Mal nein. Die Ziele und Schwerpunkte sind im jetzigen Botschaftsentwurf zu vage formuliert und erwecken den Eindruck, dass die Interessen der Schweiz höher gewertet werden als die Interessen der betroffenen Bevölkerung und die Armutsreduktion. Diese ist gemäss Bundesverfassung ein Grundauftrag der IZA, sie wird im erläuternden Bericht jedoch kaum erwähnt. Vor allem bei der anvisierten Fokussierung auf die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor muss der Akzent auf der Schaffung von menschenwürdigen Arbeitsplätzen sowie auf der Unterstützung lokaler KMU in den Partnerländern liegen. Die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Privatsektor und international tätigen Firmen muss abhängig gemacht werden von wirksamen Prozessen der Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten, Umweltrisiken und Steuerpraktiken und darf auf keinen Fall zu einer Verdrängung oder Konkurrenzierung von lokalen Firmen führen.
Download der Vernehmlassungsantwort von Alliance Sud.
Für weitere Informationen:
Kristina Lanz, Fachverantwortliche Entwicklungspolitik, Alliance Sud, Tel. +4178 913 15 00
[1] Siehe: OECD Development Co-operation Directorate (2019). Review of the Development Co-operation policies and programmes of Switzerland. The DAC’s main findings and recommendations. S. 3
Artikel teilen
Medienmitteilung
Konzernlobby gewinnt im Ständerat
18.12.2019, Internationale Zusammenarbeit
Der Ständerat hat heute einen Alibi-Gegenvorschlag verabschiedet. Damit hat sich die Konzernlobby durchgesetzt. Konzerne sollen nicht für angerichtete Schäden geradestehen müssen, sondern bloss einmal im Jahr eine Hochglanzbroschüre veröffentlichen.

Nach dem heutigen Entscheid des Ständerats wird die Schweiz höchstwahrscheinlich nächstes Jahr über die Konzernverantwortungsinitiative abstimmen. Der von Bundesrätin Keller-Sutter kurzfristig zurechtgezimmerte Alibi-Gegenvorschlag fand im Ständerat eine Mehrheit. Diese Vorlage wird selbstverständlich nicht zu einem Rückzug der Initiative führen, da sie keinerlei verbindliche Regeln bringt, welche Menschenrechtsverletzungen durch Konzerne verhindern.
Die Mehrheit des Ständerats stellt sich mit dem heutigen Entscheid schützend vor skrupellose Grosskonzerne wie Syngenta und Glencore und will, dass diese Konzerne auch in Zukunft nicht für Menschenrechtsverletzungen geradestehen müssen. Der verabschiedete Alibi-Gegenvorschlag bringt keinerlei Verbesserungen, soll aber den Stimmberechtigten vorgaukeln, dass es die Konzernverantwortungsinitiative nicht mehr brauche.
Dick Marty ist überzeugt, dass die Bevölkerung dieser Trickserei nicht auf den Leim gehen wird: «Ich bin überzeugt, dass der Alibi-Gegenvorschlag die Stimmberechtigten nicht verunsichern wird. Denn wir alle wissen, dass gerade die skrupellosesten Grosskonzerne noch so gerne Hochglanzbroschüren veröffentlichen. Konzerne wie Glencore werden erst anständig wirtschaften, wenn Menschenrechtsverletzungen auch Konsequenzen haben und sie dafür geradestehen müssen.»
Abstimmung nächstes Jahr
Die Abstimmung findet wahrscheinlich im Herbst / Winter 2020 statt. Der Abstimmungskampagne sieht Dick Marty gelassen entgegen: «Die grosse Unterstützung – gerade auch aus Wirtschaftskreisen – stimmt mich optimistisch. Ich bin sehr zuversichtlich, denn unsere Initiative fordert eine Selbstverständlichkeit. Wenn Konzerne das Trinkwasser vergiften oder ganze Landstriche zerstören, sollen sie dafür geradestehen.»
Breite Unterstützung
Bereits heute geniesst die Initiative sehr breite Unterstützung:
120 Menschenrechts-, Umwelt-, Entwicklungs- und Konsumentenorganisationen.
Wirtschaftskomitee aus über 160 Unternehmer/innen
Über 120 Politiker/innen aus BDP, CVP, GLP, FDP und SVP im «Bürgerlichen Komitee für Konzernverantwortung»
Schweizer Bischofskonferenz, der Schweizerische Evangelische Kirchenbund, die Schweizerische Evangelische Allianz (durch ihre AG Interaction), der Verband Freikirchen Schweiz sowie zahlreiche weitere kirchliche Akteure («Kirche für KoVI»)
300 Lokalkomitees mit Tausenden Freiwilligen
Chronologie Diskussion im Parlament
Nach über zwei Jahren Beratungen in 20 Kommissionssitzungen und trotz zweimaliger klarer Zustimmung des Nationalrates hätte der Ständerat heute die Gelegenheit gehabt, einen breit getragenen Kompromiss zu verabschieden. Dieser beinhaltete zwar erhebliche Abstriche gegenüber der Konzernverantwortungsinitiative, hätte aber doch zu minimalen Regeln gegen die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen durch Konzerne geführt.
Die Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, breite Teile der Wirtschaft (z.B. Coop, Migros, Manor oder ein beträchtlicher Teil der Westschweizer Wirtschaft) hatten sich hinter den Gegenvorschlag gestellt. Und die Initiant/innen hatten angekündigt, im Falle einer definitiven Verabschiedung die Initiative zurückzuziehen.
Jetzt liegt es am Nationalrat, ob er an seinem Gegenvorschlag festhalten will. Mit dem heutigen Entscheid des Ständerats ist aber eine Abstimmung sehr wahrscheinlich geworden.
Das fordert die Initiative
Die Initiative will Konzerne mit Sitz in der Schweiz verpflichten, die Menschenrechte nicht zu verletzen und die Umwelt nicht zu zerstören. Damit sich alle Konzerne an das neue Gesetz halten, sollen Verstösse in Zukunft Konsequenzen haben. Konzerne sollen deshalb für Menschenrechtsverletzungen geradestehen, welche ihre Tochterfirmen verursachen.
Artikel teilen
