Artikel teilen

global
Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.
Interview mit Micheline Calmy-Rey
21.03.2024, Internationale Zusammenarbeit
Alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey vermisst in der aktuellen Krisenzeit eine klare Haltung der Schweizer Diplomatie zu Gaza und der Ukraine. Als Garantin der Genfer Konventionen müsse sie ihr Engagement zugunsten der Zivilbevölkerung verstärken.

Verwüstungen nach dem Freitagsgebet: palästinensische Jugendliche und israelische Soldaten geraten in Ramallah regelmässig aneinander. Die Stadt ist umgeben von drei von der UNRWA verwalteten Vertriebenenlagern und nahezu 1000 NGOs. © Klaus Petrus
«global»: Frau Calmy-Rey, 20 Jahre nach der Lancierung der Genfer Initiative erlebt der Nahe Osten den schlimmsten Krieg seit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948. Wie beurteilen Sie die Rolle der Schweiz in diesem Konflikt?
Die von der Schweiz unterstützte Genfer Initiative war ein alternativer Friedensplan, der von den Zivilgesellschaften Palästinas und Israels unterzeichnet wurde und auf eine umfassende Beilegung des Konflikts und eine Zwei-Staaten-Lösung abzielte. Im Jahr 2022 entzog das EDA dieser Initiative die Unterstützung, sprach sich aber weiterhin für eine Zwei-Staaten-Lösung aus. Es ist offensichtlich, dass das Ziel eines palästinensischen Staates auf der internationalen Agenda des letzten Jahrzehnts zweitrangig geworden ist. Der als aussichtslos betrachtete Konflikt wurde ausgeblendet und die Zwei-Staaten-Lösung weiterhin propagiert – doch blieben die westlichen Länder hinsichtlich ihrer Verwirklichung tatenlos. Nichts verdeutlicht dies besser als die Schwächung der Palästinensischen Autonomiebehörde. Die Auffassung war, dass die Normalisierung der Beziehungen der Golfstaaten zu Israel den Konflikt im Handumdrehen lösen würde; wie man sieht, ist dies aber nicht der Fall. Heute taucht die Idee der Zwei-Staaten-Lösung wieder auf, doch bleibt ihre Umsetzung schwierig, da die Fragen des Status von Jerusalem, des Siedlungsbaus und des Rückkehrrechts der Flüchtlinge weiterhin einer Antwort harren.
Davon abgesehen haben sich die Zeiten geändert. Ist die Zwei-Staaten-Lösung heute nicht noch schwieriger umzusetzen als vor 20 Jahren?
Ja, da haben Sie Recht. Nehmen Sie die Entwicklung der Zahl der jüdischen Siedler:innen in den besetzten palästinensischen Gebieten: 1993 waren es 280’000, heute sind es 700’000. Der Bau des Trennzauns hat das Westjordanland in vollkommen unregierbare Mikro-Enklaven verwandelt. Über 90% des Landes zwischen Mittelmeer und Jordan stehen unter direkter israelischer Kontrolle. Bisher ist die Zwei-Staaten-Lösung nichts als ein frommer Wunsch.

Checkpoint Qalandia: Zum Ende der Zweiten Intifada wurde eine teils sieben Meter hohe Mauer erbaut, die heute das Westjordanland von Jerusalem und Israel trennt. © Klaus Petrus

Bau einer israelischen Siedlung bei Bet El nordöstlich der palästinensischen Stadt Ramallah. © Klaus Petrus
Wie beurteilen Sie die derzeitige Arbeit der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit in der Region?
Es fällt mir schwer, eine klare Position der Schweiz zu erkennen. Ihre Aussagen sind inkonsistent. In ihrer offiziellen Stellungnahme rief sie die Parteien dazu auf, ihren Verpflichtungen gemäss Völkerrecht und humanitärem Völkerrecht nachzukommen. Zusammen mit 120 anderen Staaten stimmte sie an der UNO einer Resolution der Generalversammlung zu, die zu einem sofortigen humanitären Waffenstillstand aufrief. Bestimmte Kreise kritisierten diese Haltung jedoch. Gleichzeitig erklärte der Vorsteher des Aussendepartements (EDA), dass die Schweiz die Finanzierung von 11 Organisationen in Palästina und Israel aussetze, und kam damit dem Wunsch einiger politischer Parteien nach, zu prüfen, ob die Entwicklungshilfe zugunsten Palästinas gestrichen werden sollte. Letztendlich waren dann nur drei palästinensische Organisationen von diesem Finanzierungsstopp betroffen. In der Budgetberatung hat das Parlament in der Wintersession auch beschlossen, die 20 Millionen Franken, die der Bund jährlich an das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) zahlt, nicht zu kürzen. Doch nach der Ankündigung der sofortigen Entlassung von 12 Mitarbeitern, die verdächtigt werden, mit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober in Verbindung zu stehen, könnte sich dies wieder ändern. Das Risiko ist leider nicht unerheblich, dass der Beitrag der Schweiz an die UNRWA letztendlich ausgesetzt wird, und dies trotz des humanitären Notstands in Gaza.
Es fällt mir schwer, eine klare Position der Schweiz zu erkennen.
Was halten Sie von der Ankündigung der Schweiz, eine Friedenskonferenz zur Ukraine organisieren zu wollen?
Die offizielle Schweiz hat dies am WEF in Davos angekündigt. Üblicherweise finden zuerst Vorgespräche statt und es werden die Ziele des Treffens festgelegt; erst danach erfolgt die öffentliche Ankündigung. In Davos hat die Schweiz das Vorgehen umgekehrt. Im Übrigen ist die Situation anders als bei einer klassischen Vermittlung zwischen zwei Staaten, die sich in einem Konflikt befinden. Der Friedenskonferenz gehen vier Treffen von Sicherheitsberater:innen aus über 80 Ländern voraus. Alle waren öffentlich, das letzte fand in Davos statt. Es ist also eine angepasste Methodik festzustellen. Ich bin froh, dass die Schweiz sich bewegt und ihre – nicht zu vernachlässigenden – Stärken nutzt. Dennoch kann man zum jetzigen Zeitpunkt erst von einer «Vor-Vorbereitung» sprechen.
Was sehen Sie als nächsten Schritt?
Es ist unwahrscheinlich, dass Russland direkt am ersten Gipfeltreffen teilnimmt. Gleichzeitig ist eine Friedenskonferenz ohne Russland undenkbar. In Davos haben unsere Präsidentin und unser Aussenminister ihr Anliegen, Russland einzubeziehen, zum Ausdruck gebracht. Sie bekräftigten, dass die Schweiz mit möglichst vielen Staatschefs und -chefinnen zusammenarbeiten wolle, insbesondere mit den Staaten, die sich bislang eher auf der Seite Russlands positioniert haben. Wenn die Schweiz tatsächlich die Diskussion mitgestalten und sich nicht nur auf die Rolle der Gastgeberin beschränken will, wird sie auch inhaltliche Akzente setzen müssen. Deshalb ist die Teilnahme von russlandfreundlichen Staaten und von Russland selbst wichtig. Eine Einigung über die meisten Punkte des ukrainischen Friedensplans ist zum jetzigen Zeitpunkt unrealistisch. Die Schweiz müsste diejenigen Punkte bestimmen, bei denen sich ein gemeinsamer Nenner zwischen den Unterstützern der Ukraine und jenen Russlands abzeichnet. Darüber hinaus gibt es technische Herausforderungen, bei denen im Interesse der Parteien Zwischenvereinbarungen getroffen werden könnten, z. B. über Getreide, Gefangenenaustausch, die Sicherheit von Atomkraftwerken etc.
Ich wünschte mir, dass die Schweiz sich lauter und deutlicher zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts bekennen würde.
Sie waren die treibende Kraft hinter der Schweizer Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat. Welche Bilanz ziehen Sie nach einem Jahr?
Im Sicherheitsrat konnte die Schweiz ihre traditionelle Aussenpolitik fortsetzen. Mit Brasilien erleichterte sie den humanitären Zugang nach dem Erdbeben in Nordsyrien. Aber sie zog in einer Zeit in den Sicherheitsrat ein, in der der Multilateralismus auf der Kippe steht und durch das Veto der Grossmächte blockiert wird. Ich hätte erwartet, dass sie sich etwas dynamischer für die Anwendung des humanitären Völkerrechts einsetzt. Es ist schade, dass sie in dieser Hinsicht nicht mehr tut, denn was in der Ukraine oder im israelisch-palästinensischen Konflikt geschieht, wo die Genfer Konventionen von allen Seiten mit Füssen getreten werden, ist schlicht inakzeptabel: Seien es die wahllosen Bombardierungen in Gaza oder die kriegsverbrecherischen Angriffe der Hamas vom 7. Oktober – es ist nicht hinnehmbar, dass zahlreiche israelische Zivilist:innen hingerichtet werden, dass Palästinenser:innen in Gaza von der Hamas in eine Falle gelockt werden und dass die Auslieferung von Hilfsgütern behindert wird. Ich wünschte mir, dass die Schweiz sich lauter und deutlicher zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts bekennen würde. Immerhin ist Genf dessen Geburtsstätte und die Schweiz Garantin der Genfer Konventionen.

Westmauer oder Klagemauer im Jüdischen Viertel der Altstadt von Jerusalem mit jüdischen Gläubigen und Ultraorthodoxen. © Klaus Petrus
Gleichzeitig wirkt der Multilateralismus angeschlagen... Haben Sie noch Vertrauen in die UNO-Institutionen, und welche Rolle sollten die Schweiz und das internationale Genf spielen?
Der Sicherheitsrat wird durch Vetos beider Seiten blockiert. Genf ist Heimat vieler technischer Organisationen, und wenn man von der Erosion des Multilateralismus spricht, gilt es, hier genau hinzuschauen. Das Palais des Nations wurde kürzlich zwei Wochen lang geschlossen, um Heizkosten zu sparen, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) wird 4’000 Stellen abbauen und auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) plant Entlassungen im grossen Stil. Genf beherbergt eine beeindruckende Anzahl technischer UN-Organisationen, die sich momentan in Schwierigkeiten befinden. Die UNO ist aber auch auf Daten angewiesen, die für das reibungslose Funktionieren der Globalisierung notwendig sind: Sie kümmert sich um Mobilfunkfrequenzen, Patente und Marken, öffentliche Gesundheit, Arbeitsbedingungen, Klima, Koordination der humanitären Hilfe. Bei den Vereinten Nationen herrscht erheblicher Reformbedarf. Dies gilt nicht ausschliesslich für den Sicherheitsrat, sondern auch für die technischen Organisationen, deren Arbeitsabläufe effizienter werden müssen.
Wie beurteilen Sie die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz? Sollte Ihrer Meinung nach auf das reguläre Budget der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) zugegriffen werden, um den Wiederaufbau in der Ukraine zu finanzieren?
Laut Website der DEZA fördert sie die politische und wirtschaftliche Autonomie der Staaten. Die Priorität der Schweiz war und ist es, den ärmsten Bevölkerungsgruppen zu helfen. Auf jeden Fall halte ich es für aussenpolitisch unhaltbar, die Hilfe für die ärmsten Länder – ein regulärer Budgetposten mit jährlicher Fortschreibung und ein nachhaltiges Ziel der DEZA – zu kürzen, um sie für die Wiederaufbauhilfe in der Ukraine zu verwenden. Letzteres ist sicherlich ein hehres und notwendiges Ziel, das jedoch hoffentlich zeitlich begrenzt ist und meiner Meinung nach eine Sonderfinanzierung erhalten sollte.
Es ist für die Schweizer Bevölkerung schwer zu verstehen, warum keine Waffen an die Ukraine geliefert werden, an Saudi-Arabien, das im Jemen Krieg führt, hingegen schon.
Existiert die Schweizer Neutralität heute noch?
Die Schweiz betreibt heute die Politik eines neutralen Staates. Sie liefert keine Waffen an Kriegsparteien, weder direkt noch über Vermittler. Sie verurteilt den Angriffskrieg Russlands, weil er gegen das Völkerrecht verstösst. Sie verhängt Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Wäre die Verurteilung des russischen Vorgehens nicht von Sanktionen begleitet gewesen, hätte die Schweiz die Umgehung der EU-Sanktionen ermöglicht und sich damit auf die Seite des Aggressors gestellt. Nichtsdestotrotz ist es für die Schweizer Bevölkerung schwer zu verstehen, warum keine Waffen an die Ukraine geliefert werden, an Saudi-Arabien, das im Jemen Krieg führt, hingegen schon. Der Krieg in der Ukraine ist atypisch für unsere Zeit. Bewaffnete Konflikte zwischen Staaten sind heute die Ausnahme. Was zunimmt, sind zivile Konflikte, ebenso wie Cyberangriffe. Und was tun, wenn die Dinge noch komplizierter werden? Gemäss dem Neutralitätsrecht ist der Export von Waffen nach Saudi-Arabien nicht verboten, da es sich im Jemen nicht um einen zwischenstaatlichen bewaffneten Konflikt handelt. Wie man sieht, stellt die Definition von Krieg durch das Neutralitätsrecht eine Herausforderung dar.
Als Sondergesandte der Generalsekretärin der Internationalen Organisation der Frankophonie für die Beobachtung der Lage in Madagaskar haben Sie kürzlich eine Wahlmission der Frankophonie in Antananarivo geleitet. In diesem Jahr wird eine Rekordzahl von Menschen weltweit an Wahlen teilnehmen. Ist dies eine entscheidende Bewährungsprobe für die Demokratie?
In Madagaskar war die Frage, die sich der Gemeinschaft gleichgesinnter Länder (Schweiz, EU, USA und westliche Staaten) stellte, etwas anders gelagert. Madagaskar ist eine Schnittstelle zwischen Afrika und China, mit einer chinesischen und russischen Präsenz. Die Gemeinschaft gleichgesinnter Länder beobachtete den Wahlprozess und gab Kommentare ab. Sie wünschte sich einen inklusiveren, transparenteren und offeneren Wahlprozess, erklärte sich aber aus geopolitischen Gründen bereit, einen suboptimalen Prozess zu finanzieren, der in der Wahl des amtierenden Präsidenten endete. Wohlgemerkt: Madagaskar ist sehr arm und die Wahlprozesse können nicht mit den Massstäben der Schweiz beurteilt werden. Nicht alle Madagass:innen haben Zugang zu Elektrizität, nicht alle Wahllokale sind vernetzt und es mangelt an Kommunikationsmitteln.
Das Interview wurde Ende Januar 2024 geführt und aus dem Französischen übersetzt.

Micheline Calmy-Rey
Alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey war von 2002 bis 2011 Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Sie verfolgte eine aktive Neutralitätspolitik und brachte die Schweiz in mehreren Fällen als internationale Vermittlerin und Friedensförderin ins Spiel. Bekanntestes Beispiel ist die Vermittlung zwischen der Russischen Föderation und Georgien, die 2011 den Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation ermöglichte. Nennenswert sind auch die Vermittlungen zwischen der Türkei und Armenien. Im Jahr 2008 verhandelte Micheline Calmy-Rey erfolgreich über die Vertretungsabkommen Georgiens in Russland und umgekehrt.
Artikel teilen

global
Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.
Statement zur Lage im Nahen Osten
23.04.2024, Internationale Zusammenarbeit
Nach dem Massaker der radikalislamischen Hamas an der israelischen Zivilbevölkerung und dem darauffolgenden Kriegsausbruch hat sich die Lage im Gazastreifen katastrophal verschlechtert. Nach wie vor werden rund 100 Geiseln festgehalten. Schulen, Spitäler und weite Teile der zivilen Infrastruktur wurden zerstört. Die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Nahrungsmitteln und sauberem Trinkwasser ist in grossen Teilen des Gebiets zusammengebrochen. Es ereignet sich eine humanitäre Katastrophe und die internationale Staatengemeinschaft schaut zu.

Auch die UNO-Fahrzeuge werden in Gaza immer wieder zur Zielscheibe, so am 9. April in Chan Yunis. © Mohammed Saber / EPA-Keystone
Der Krieg zwischen der Hamas und Israel trifft insbesondere die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Viele haben kein Dach mehr über dem Kopf, die Lebensmittelversorgung ist kollabiert. Oftmals haben die Menschen alles verloren, nichts zu essen, sind nirgendwo sicher und können nicht mehr fliehen. So betont auch die IKRK-Präsidentin Mirjana Spoljaric-Egger, dass es kaum noch Möglichkeiten für humanitäre Hilfe im Gazastreifen gebe: Die Einfuhr von Medikamenten und anderen Hilfsgütern sei schwierig. Es gebe keine sicheren Orte mehr, der Zugang zu Medizin sei kaum noch vorhanden, jener zu Wasser massiv eingeschränkt. Es sei schwer nachzuvollziehen, wie die Konfliktparteien den versprochenen Schutz für die Zivilbevölkerung noch gewährleisten wollen, sagte Spoljaric in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Mitte Februar. Zwei Monate später stehen die Menschen im Norden des Gazastreifens, den die israelische Armee vom Süden abgetrennt hat, vor einer Hungersnot. Bereits sind Kinder an Hunger gestorben.
Der Grossteil der 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen ist heute in den Schulen und Notunterkünften der UNRWA – dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten – untergebracht. «Wenn es sie [die UNRWA] nicht mehr gäbe, würde es in Gaza so gut wie gar keine humanitären Operationen mehr geben», sagte Martin Griffiths, UN-Koordinator für humanitäre Soforthilfe Ende März bei seinem Besuch in der Schweiz. Doch die Rolle der UNRWA im Nahost-Konflikt ist bereits seit Jahren ein heftig diskutiertes Thema. Sie sei politisch nicht neutral, sie sei von der Hamas unterwandert, sie sei Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Viele der Vorwürfe sind aber nicht von unabhängiger Seite belegt. Wer diesen Vorwürfen entgegnen möchte, beisst auf Granit. Von den Kritiker:innen wird nicht gesehen, dass die UNRWA Teil des UNO-Systems ist und umfassende Rechenschaft gegenüber den UNO-Mitgliedsstaaten ablegen muss.
So zeigt auch der am Montag publizierte Untersuchungsbericht einer unabhängigen Expertengruppe, dass die Anschuldigungen unberechtigt sind. Die Expertinnen und Experten kommen zum Schluss, dass die UNRWA über eine Vielzahl von Mechanismen und Verfahren verfügt, um a) die Einhaltung des Grundsatzes der Neutralität zu gewährleisten; b) bei Hinweisen auf Verstösse rasch und angemessen reagieren zu können (z.B. über Melde- und Untersuchungssysteme); und c) Massnahmen gegen Mitarbeitende einzuleiten, falls es zu Verstössen kommen sollte.
Nur die UNRWA verfügt über die Strukturen, das Personal und das Fachwissen, um die ausreichende Zufuhr und Verteilung lebensnotwendiger Hilfsgüter zu gewährleisten. Die Gesamtheit der UNRWA mit ihren 30'000 Mitarbeiter:innen und die Millionen von notleidenden Hilfsempfänger:innen, insbesondere im Gazastreifen, dürfen unter keinen Umständen für mutmassliche Verbrechen von Einzelpersonen unter Kollektivstrafe gestellt werden. Würde die Schweiz die Finanzierung der UNRWA stoppen und damit das einzige Werkzeug schwächen, mit dem die menschgemachte Hungersnot allenfalls noch gestoppt werden kann, wäre die Glaubwürdigkeit der humanitären Schweiz auf lange Sicht beschädigt. Unterbindet die Schweiz ihre Hilfe, trüge sie für die humanitäre Katastrophe und den zu befürchtenden Hungertod Tausender eine Mitverantwortung.
UNRWA-Kritiker:innen, die gleichzeitig die humanitären Abgründe im Gazastreifen anerkennen, rufen dazu auf, die Gelder statt der UNRWA anderen Organisationen, etwa dem IKRK, zur Verfügung zu stellen. Diesen Kritiker:innen ist offensichtlich nicht bewusst, dass die UNRWA in der Region eine quasi-staatliche Rolle einnimmt, die nicht nur in der humanitären Hilfe alternativlos ist. So bestätigte auch Philippe Lazzarini, der Generalkommissar der UNRWA, gegenüber der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats Ende März, dass keine andere Organisation die Kapazitäten hat, um die Aufgaben der UNRWA zu übernehmen.
Auf die Schweiz übertragen würde das bedeuten, dass von heute auf morgen das gesamte Gesundheitssystem, die Sozialdienste sowie alle Bildungseinrichtungen der Kantone Zürich und Aargau von einer anderen Organisation übernommen und geführt werden müssten. Um dem Vorwurf Rechnung zu tragen, das UNRWA-Personal sei von der Hamas unterwandert, müssten auch noch alle Angestellten ausgewechselt werden. Ein solcher institutioneller Umbau wäre selbst in der Schweiz mit ihrer guten Gouvernanz undenkbar, geschweige denn in einem schwer kriegsversehrten Gebiet wie dem Gazastreifen. Kurz: In der aktuellen humanitären Not könnte im Gazastreifen ohne die UNRWA gar keine Hilfe mehr geleistet werden.
Die UNRWA wurde 1949 als Übergangslösung gegründet. Durch die Verhärtungen im Nahostkonflikt und auf Grund der Tatsache, dass sämtliche Versuche, ihn zu lösen, in den letzten 80 Jahren gescheitert sind, wurde diese Übergangslösung zum Dauerzustand. Umso mehr drängt sich heute die Frage auf, wie eine politische Lösung aussehen könnte, die von allen Konfliktparteien akzeptiert wird und allen Menschen in der Region neue Perspektiven eröffnet. Angesichts des aktuellen menschlichen Elends im Gazastreifen ist eine politische Lösung dringlicher denn je.
Alliance Sud fordert deshalb, dass…
Artikel teilen
Artikel, Global
20.03.2024, Internationale Zusammenarbeit
Die Erfolgsquote der Entwicklungszusammenarbeit ist immer wieder ein Thema in den Medien und im Parlament. Die laufende Debatte sagt aber mehr aus über die Schwachstellen der Evaluationen und die mangelhafte Kommunikation als über die tatsächliche Wirkung der Projekte.
Diskussion mit einer Frauengruppe in Madagaskar. © Andry Ranoarivony
Während die Entwicklungsagenturen DEZA (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit) und SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft) gern ihre Erfolge betonen, nehmen Parlament und Medien regelmässig aktuelle Krisenherde, wie etwa Afghanistan, zum Anlass, um die fehlende Wirkung der IZA zu bemängeln. Aber wie wird die Wirksamkeit der internationalen Zusammenarbeit (IZA) überhaupt gemessen, und macht die aktuelle Art der Wirkungsmessung eigentlich Sinn? Letztere Frage stellte sich auch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Ständerats. Sie beauftragte die Parlamentarische Verwaltungskontrolle (PVK) mit einer Untersuchung der Instrumente der Wirksamkeitsmessung der IZA, wobei die Studie auf das am häufigsten verwendete Instrument – die Evaluationen – fokussierte. Der Bericht der PVK sowie die Stellungnahme des Bundesrats liegen nun vor und zeigen vor allem eins: Während Evaluationen als Steuerungsinstrumente nützlich sind, taugen sie wenig zur Wirkungsmessung.
Gegenüber dem Parlament wird die Wirksamkeit der IZA anhand von Erfolgsquoten ausgewiesen, wobei sowohl die DEZA wie auch das SECO überdurchschnittlich hohe Erfolgsquoten von über 80% aufweisen. Diese Erfolgsquoten basieren auf einem Zusammenzug externer projektspezifischer Evaluationen. Wie die PVK aufzeigt, ist dies aus verschiedenen Gründen problematisch: Die Qualität der einzelnen Evaluationen fällt unterschiedlich aus und es gibt keine einheitliche Methodik; die meisten Evaluationen werden während der Laufzeit der Projekte durchgeführt und sagen somit nichts über die nachhaltige Wirkung der Projekte aus; die Empfehlungen der einzelnen Evaluationen werden als mangelhaft eingestuft und das Follow-up seitens DEZA, SECO und der Abteilung Frieden und Menschenrechte (AFM) des EDA ist nicht immer gegeben; zudem nehmen die einzelnen Evaluationen kaum Bezug auf die übergeordneten Ziele der IZA.
Aus diesen Ergebnissen nun zu folgern, die IZA sei nicht wirksam, wäre aber falsch – wie auch die GPK des Ständerats klar festhält. Sie geht «grundsätzlich davon aus, dass die Schweiz viele ihrer Ziele in der IZA erreicht und nutzbringende Projekte durchführt». Sie kritisiert aber «die bisherige Praxis des Bundesrats, mittels fragwürdiger Erfolgsquoten Rechenschaft über die Wirksamkeit der IZA abzulegen». Auch geht es der GPK nicht darum, Evaluationen per se abzuschaffen oder als nutzlos zu erklären, da sie als interne Steuerungsinstrumente durchaus sinnvoll sein können, wenn sie denn sinnvoll konzipiert und intern auch tatsächlich zur Steuerung, das heisst zur Anpassung von Projekten, genutzt werden.
Neben der kritischen Evaluation der existierenden Praxis der Wirkungsmessung wird nun auch in der Schweiz der Ruf nach evidenzbasierten Ansätzen und Wirkungsanalysen lauter. Zum einen bedeutet dies, dass wissenschaftliche Evidenz vermehrt Einzug findet in die Ausgestaltung und Konzipierung neuer Projekte, zum anderen sollen vermehrt wissenschaftliche Wirkungsanalysen durchgeführt werden. Diese wiederum beziehen sich vor allem auf so genannte randomisierte Feldstudien (randomized control trials – RCTs), welche in den letzten Jahren durch die Arbeit der Nobelpreisträger:innen Esther Duflo und Abhijit Banerjee massiv an Aufwind erhalten haben. Das Prinzip ist einfach: Bei der Projektkonzipierung werden nach dem Zufallsprinzip zwei Gruppen geformt – eine, welche vom Entwicklungsprojekt profitiert, eine andere, welche nicht davon profitiert. Als Beispiel: Mehrere Schulen in Kenia werden per Zufallsprinzip ausgewählt – in der Hälfte der Schulen werden Schulbücher an die Kinder verteilt, die Kinder der Kontrollgruppe bekommen keine Schulbücher. Vor und nach der Verteilung der Schulbücher werden sowohl die Schulpräsenz wie auch die Noten aller Kinder erfasst. Nach einem Jahr werden wiederum dieselben Daten erhoben. Weist die Gruppe, welche Schulbücher erhalten hat, tatsächlich eine höhere Schulpräsenz und bessere Noten auf, lässt sich daraus schliessen, dass das Projekt gewirkt hat und man es in anderen Kontexten replizieren kann. So zumindest die Theorie.
Wo bleibt nun also die Lösung? Sowohl Steuerzahler:innen wie auch Entwicklungsorganisationen und von Armut betroffene Menschen haben ein Interesse daran, dass die IZA wirkt. Aber brauchen wir dazu wirklich immer mehr Zahlen und Statistiken? Die aktuelle Praxis, welche oft auf starren Bürokratien, Planungsinstrumenten und Evaluationen basiert, sagt wenig aus über den tatsächlichen Mehrwert der IZA. Und randomisierte Feldstudien eignen sich im besten Fall für einen kleinen Teil an IZA-Projekten.
Das Parlament und die Öffentlichkeit verdienen vor allem eins: eine ehrliche Debatte zur IZA – zu den Erfolgen wie auch zu den Herausforderungen. Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz weist viele Erfolge auf, die durch einzelne Projekte wie auch durch wissenschaftliche Studien vielfach belegt sind. Aber um Wirkung zu entfalten, braucht es oft auch Zeit. Gerade im Bereich der Rechtsstaatlichkeit oder der Stärkung der Zivilgesellschaft vor Ort – beides grundlegende Faktoren für eine nachhaltige Entwicklung – ist eine sofortige Wirkung nicht immer klar erreichbar. Diese kann darüber hinaus gerade in Krisenzeiten schnell wieder zunichte gemacht werden, wie etwa das Beispiel Afghanistan zeigt.
Abgesehen von besserer Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit kann die Praxis und auch die Wirkung der IZA durchaus profitieren von einem besseren Einbezug existierender und der Förderung eigener wissenschaftlicher Studien – dies vor allem auf der Ebene der thematischen und Länderstrategien. In der Projektarbeit selbst braucht es aber eher mehr Flexibilität anstatt Rigidität, wobei es wichtig ist, dass alle Projekte eine klare Wirkungsorientierung aufweisen. Das bedeutet konkret, dass gemeinsam mit lokalen Partnern Zielvorgaben erarbeitet werden, die sich klar an den im Gesetz festgeschriebenen Zielen orientieren, d. h. der Linderung von Not und Armut, der Achtung der Menschenrechte und der Förderung der Demokratie sowie dem friedlichen Zusammenleben der Völker und der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (Art. 54 Abs. 2 BV), wie auch an den konkreten Zielen der IZA-Strategie. Anstelle starrer Logframes für die Projektimplementierung sollten Massnahmen (und wenn nötig auch die Ziele) jederzeit angepasst werden können, wenn sich herausstellt, dass die angedachten Aktivitäten doch nicht sinnvoll sind oder der Kontext sich ändert. Dies setzt ein kontinuierliches Monitoring voraus, welches durchaus von den Implementierungspartnern übernommen werden kann, zumal die Partner vor Ort meistens am besten wissen, wann welche Anpassungen nötig sind. Evaluationen nach dem Abschluss von Projekten können zudem hilfreich sein, um festzustellen, ob und wie die gesetzten Ziele erreicht wurden. Allerdings macht es Sinn – wie der Bericht der PVK auch feststellt –, diese Evaluationen departementsübergreifend nach klaren Kriterien zu gestalten.
Artikel teilen

global
Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.
Interview
05.04.2024, Internationale Zusammenarbeit
Eine Anfang April publizierte repräsentative Umfrage der ETH Zürich zeigt, dass trotz globaler Konflikte und wirtschaftlicher Unsicherheiten die Entwicklungszusammenarbeit in der Schweizer Bevölkerung eine breite Unterstützung geniesst, die sogar jene für die Armee übertrifft. Für Fritz Brugger, Co-Direktor des Zentrums für Entwicklung und Zusammenarbeit (NADEL) der ETH, muss jetzt auch in der Politik ein Umdenken stattfinden.

© Daniel Winkler / ETH Zürich
Alliance Sud: Gemäss der neuen NADEL-Umfrage ist die Schweizer Bevölkerung sehr besorgt über die globale Armut. Wirkt sich das auch auf ihre Solidarität und ihr Engagement aus?
Fritz Brugger: Das Engagement der Schweizer Bevölkerung ist und bleibt hoch. Jede zweite erwachsene Person hat im vergangenen Jahr gespendet. Das ist beachtlich und erfreulich, gerade wenn man an die steigenden Lebenshaltungskosten denkt. Diese haben lediglich zu einem leichten Spendenrückgang von knapp drei Prozent geführt. Im umliegenden Ausland spenden etwa 36% der Bevölkerung für wohltätige Zwecke.
Die Zustimmung für die Entwicklungszusammenarbeit ist grösser als für die Armee, und dies in Zeiten des Krieges in Europa. Wie erklären Sie das?
Die Bevölkerung hat sehr wohl verstanden, dass Sicherheit nicht primär eine militärische Frage ist, sondern dass globale Stabilität vor allem von «menschlicher Sicherheit» abhängt. Das heisst: Sicherheit basiert in unserer globalisierten und vernetzten Welt auf der Verwirklichung der Menschenrechte und auf umweltverträglichem und sozial gerechtem Fortschritt für alle Menschen.
Quelle: ETH NADEL, Umfrage Globale Zusammenarbeit Schweiz 2023
Laut Sicherheitsstudie der ETH befürwortet auch in der politischen Mitte eine deutliche Mehrheit von 60% eine Erhöhung der Entwicklungszusammenarbeit. Politisiert der Bundesrat am Volk vorbei?
Das Parlament, welches das vom Bundesrat vorgeschlagene Budget bewilligt, muss zwischen politischen Zielen priorisieren, wenn nicht alle erfüllt werden können oder sie nicht miteinander vereinbar sind. Zudem ist auch in unserer direkten Demokratie das Parlament nur mit Einschränkungen ein Spiegel des Volkswillens, da dürfen wir uns nichts vormachen. Viele Parlamentarier:innen werden gleichzeitig dafür bezahlt, dass sie Partikularinteressen vertreten. Wenn im Budget-Verteilkampf Geld eingespart werden muss, dann lässt sich das am einfachsten bei Aufgabenbereichen machen, die keine bezahlte Lobby im Parlament haben. Der Einfluss von Interessenbindungen auf politische Entscheidungsträger:innen ist wissenschaftlich gut belegt. Aktuell kann man das beispielsweise beim Seilziehen um die Umsetzung des Tabakwerbeverbots beobachten, das der Souverän an der Urne beschlossen hat.
Für die Bevölkerung haben Investitionen in Bildung und Ernährungssicherheit oberste Priorität. Sollte die Schweiz ihr Engagement in diesen Bereichen ausbauen?
Gesundheit, Ernährungssicherheit und Bildung sind Grundbedürfnisse. Sie geniessen daher nicht nur eine hohe Priorität, sondern – das zeigen die Resultate unserer Umfrage – sie sind auch mehrheitsfähig über alle sozioökonomischen Gruppierungen und politischen Haltungen hinweg. Die vorhandene wissenschaftliche Evidenz zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit zeigt ausserdem, dass das Engagement im Bereich Bildung und Gesundheit das meiste Potenzial hat und gut investiert ist. Und die Bedürfnisse sind bei allen Fortschritten, zum Beispiel in der Reduktion der Kindersterblichkeit, immer noch enorm. Bei der Bildung wurden grosse Fortschritte in der Einschulung gemacht; immensen Bedarf gibt es heute bei der Qualität des Unterrichts und beim Zugang zur Sekundarstufe.
Die Bevölkerung hat verstanden, dass Sicherheit nicht primär eine militärische Frage ist, sondern auf umweltverträglichem und sozial gerechtem Fortschritt für alle basiert.
Die Förderung des Privatsektors, die von Aussenminister Cassis immer wieder propagiert wird, ist für die Befragten weniger wichtig. Ist der Bundesrat mit seiner Strategie auf dem Holzweg?
Bei der Diskussion um die Rolle des Privatsektors in der Entwicklungszusammenarbeit müssen wir drei Dinge auseinanderhalten: Zuerst die Förderung des lokalen Privatsektors in den verschiedenen Ländern. Sie basiert auf der Idee, dass letztlich die lokalen Firmen den grossen Teil der Arbeitsplätze bereitstellen. Das ist auf jeden Fall wichtig, kann aber von aussen höchstens bedingt gesteuert werden. Das zweite Thema ist die Förderung der nachhaltigen Entwicklung durch unternehmerische Verantwortung, vor allem von multinationalen Unternehmen. Das funktioniert dort, wo sich daraus unternehmerische Chancen eröffnen oder Geschäftsrisiken vermeiden lassen. Wo das nicht gegeben ist, passiert wenig. Auch das ist in der Forschung gut belegt. Das dritte ist die Mobilisierung von privatem Kapital für die Finanzierung der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Laut Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind die Erwartungen hier zu hoch. Besonders für Investitionen in den ärmsten Ländern bleibt die Mobilisierung von privatem Kapital weit hinter den Erwartungen zurück. Das gilt auch für private Investitionen in Sektoren, in denen es keinen «business case» gibt – das ist ebenfalls nicht weiter überraschend. Eine realistischere Einschätzung darüber, was vom Privatsektor geleistet werden kann und was nicht, wäre wichtig.
Quelle: ETH NADEL, Umfrage Globale Zusammenarbeit Schweiz 2023
Je besser eine Person informiert ist, desto grösser ist ihre Unterstützung für die internationale Zusammenarbeit. Die Medien berichten aber immer weniger über den Globalen Süden. Wie kann sichergestellt werden, dass die Bevölkerung über globale Zusammenhänge und Entwicklungspolitik Bescheid weiss?
Das ist schwierig. Medienwissenschaftler haben alle Tagesschau-Sendungen von 2022 ausgewertet. Danach werden für 85% der globalen Bevölkerung gerade mal 10% der Sendezeit reserviert. Das ist darum gravierend, weil 57% der Teilnehmenden in unserer Umfrage das Fernsehen als die wichtigste Informationsquelle über den Globalen Süden angegeben haben, zusammen mit Zeitungen (print: 32%, online: 47%) sowie Radio (29%). Keine andere Informationsquelle hat eine annähernd grosse Reichweite. Entwicklungsorganisationen werden von 8% der Befragten als eine der drei wichtigsten Informationsquellen genannt. Wird der Service public geschwächt, wie das verschiedene politische Initiativen zurzeit anstreben, verschärft sich das Problem weiter.
Wie zahlreiche Wissenschaftler:innen unterstützen auch Sie die Kampagne #MehrSolidaritätJetzt, mit welcher Motivation?
Weil es wichtig ist, dass sich die Schweiz als reichstes Land der Welt nicht aus der internationalen Solidarität abmeldet. Das hätte nicht nur unmittelbare Folgen für die betroffenen Menschen und die Armutsbekämpfung, sondern wäre auch nicht im Interesse der Schweiz. Wenn jetzt das Budget für die internationale Zusammenarbeit zusammengestrichen wird, wird es schwierig, es wieder zu erhöhen, nachdem die Ukraine dereinst wieder aufgebaut sein wird. Für den jetzigen Abbau wird die Schuldenbremse vorgeschoben – obwohl es einen breiten Konsens darüber gibt, dass die Schuldenbremse in der jetzigen Form zu rigoros ist und dazu führt, dass die ohnehin schon sehr tiefe Schuldenquote auf null sinkt. Reformvorschläge liegen auf dem Tisch, die einerseits den Handlungsspielraum (den wir uns selbst eingeschränkt haben) vergrössern und trotzdem eine klare Ausgabenkontrolle erlauben würden.
Es gibt einen breiten Konsens darüber, dass die Schuldenbremse in der jetzigen Form zu rigoros ist.
Wie würde ein angemessener Beitrag der Schweiz für die internationale Zusammenarbeit aussehen?
Am Anfang eines angemessenen Beitrags steht eine mutige, visionäre Strategie, welche die internationale Zusammenarbeit nicht als isoliertes Politikfeld versteht, sondern die Politik in der Schweiz, die Gestaltung der Beziehung mit den Ländern im Globalen Süden und das Entwicklungsengagement von der globalen nachhaltigen Entwicklung her denkt. Da gehört die Handels- und Steuerpolitik ebenso dazu wie die Klima- und Rohstoffpolitik. In dieser Politikkohärenz liegt die grösste Hebelwirkung, um die globale nachhaltige Entwicklung zu fördern. Politikkohärenz ist jedoch aus der Debatte praktisch verschwunden und der Trend geht in die umgekehrte Richtung. So ist die Politik beispielsweise dazu übergegangen, statt die Hausaufgaben in der Klimapolitik zu machen, diese mit Verträgen an Länder des Globalen Südens zu übertragen.
Was schlagen Sie konkret vor?
Wenn es um konkrete Entwicklungsprojekte geht, plädiere ich vor allem für thematische Beharrlichkeit und Verlässlichkeit. Das ist zwar langweilig, aber erfolgsversprechend: Die Schweiz hat sich langfristig in Themen engagiert und das hat sich in positiven Resultaten niedergeschlagen. Und dann plädiere ich für eine stärkere Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und die systematische Verwendung von Evidenz in der Planung und Erfolgskontrolle. Hier gibt es eindeutig Spielraum nach oben.
Die vollständige NADEL-Umfrage «Swiss Panel Global Cooperation 2023» finden Sie hier.
Artikel teilen
Die Südperspektive
22.03.2024, Internationale Zusammenarbeit
Bolivien leidet unter einer schweren politischen Krise und einer wirtschaftlich düsteren Lage. Und trotzdem bietet die zunehmende Urbanisierung auch Chancen bei der nachhaltigen Armutsbekämpfung, schreibt Martín del Castillo.

Markt in Coroico, Yungas, wo viele Jugendliche Kokablätter verkaufen. © Meridith Kohut / The New York Times
In ganz Lateinamerika schwanken die Bukeles und Mileis, die Ortegas und Morales mit radikalen Diskursen und populistischen Forderungen zwischen der einen und der anderen Seite. Das Pendel schwingt aber nicht mehr zwischen den ideologischen Extremen, zwischen Verstaatlichung privater Unternehmen und radikalem Liberalismus. Es scheint, dass das Hin und Her jetzt den geopolitischen Interessen einiger strategischer Verbündeter dient: Vereinigte Staaten, China, Russland, Europäische Union. Sie unterstützen die besonderen Interessen und die Machtkonzentration der «messianischen Führer», indem sie deren politische Diskurse für ihre Zwecke instrumentalisieren.
Diese Dynamik der letzten zwei Jahrzehnte hat mehrere gemeinsame Nenner: schwache Staaten, Präsidialsysteme, Machtkonzentration in den Händen weniger Personen, kooptierte und korrupte Justizsysteme, geringe Legitimität des Parteiensystems und der nationalen Parlamente sowie wirtschaftliche Abhängigkeit vom Ausland. Bolivien ist kein Ausreisser und feiert demnächst 20 Jahre Populismus (davon 17 Jahre von der Linken und zwei von der Rechten dominiert), mit all den genannten und einigen anderen landesspezifischen Merkmalen.
Wie in den meisten Ländern der Region fehlt es den politischen Parteien an Legitimität. Die politische Elite sucht sich andere Kanäle, wie Kirchen oder zivilgesellschaftliche Organisationen oder Gewerkschaften, die die Kokabauern und -bäuerinnen vertreten (die wichtigste soziale Bewegung in Bolivien, aus der Evo Morales' politische Basis stammt). Letztere werden auf der Grundlage klientelistischer Interessen mobilisiert. Die Bolivianer:innen organisieren sich, beschweren sich, protestieren, aber machen keine konstruktiven Vorschläge.
Ebenso verfügt Bolivien über ein schwaches, weitgehend korruptes und illegitimes Justizsystem. Andere staatliche Einrichtungen haben begrenzte Kapazitäten, eine hohe Personalfluktuation, extreme Bürokratie und weisen fragwürdige Verwaltungsergebnisse auf. Ende des letzten Jahrtausends lagen 25% der Mittel für öffentliche Investitionen in den Händen der nationalen Regierung und 75% bei den lokalen Regierungen; letztere haben sich bis heute auf 20% reduziert. Die Zentralisierung der öffentlichen Entscheidungen und Haushalte bringt die institutionelle Schwäche Boliviens klar zum Ausdruck.
Seit der Präsidentschaft von Evo Morales (2005 bis 2019) hat Bolivien die Armutsquote deutlich gesenkt: die extreme Armut von 38% auf weniger als 15%, die moderate Armut von 60% auf 39%. Das makroökonomische Niveau blieb einigermassen stabil: Die Inflation liegt unter dem zweistelligen Bereich, das Wirtschaftswachstum beträgt durchschnittlich fast 4%.
Während der Pandemie waren Beatmungsgeräte eine Mangelware, gerade ärmere Länder hatten keinen Zugang zu den überlebenswichtigen Maschinen. In Bolivien musste etwa medizinisches Personal per Hand Beatmungen durchführen. Aus der Not entwickelte eine bolivianische Universität ein kostengünstiges und schnell baubares automatisches Beatmungsgerät, das zum Selbstkostenpreis an abgelegene Gemeinden und ins Ausland verkauft wurde. Dies war nur dank der Unterstützung durch die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit möglich, die die Arbeit finanziert und Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren aufgebaut hat. Anlässlich der Schliessung des DEZA-Büros in Bolivien und des laufenden Ausstiegs der bilateralen Zusammenarbeit aus Lateinamerika und der Karibik im Jahr 2024 wird der freie Journalist Malte Seiwerth für Alliance Sud eine Reportage schreiben, die Sie ab April auf der Website lesen können.
Trotz solch vielversprechender Zahlen ist die derzeitige Wirtschaftslage in Bolivien nicht ermutigend: Der Anteil der informell erwerbstätigen Bevölkerung liegt bei fast 80%. Diese Menschen haben keinen Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen, erhalten keine Arbeitnehmer:innen-Leistungen und werden nicht besteuert. Hinzu kommt, dass die nachgewiesenen Gasreserven – die wichtigste Einnahme- und Exportquelle des Landes – drastisch zurückgegangen sind, der öffentliche Sektor erheblich gewachsen ist und die Subventionen für Treibstoffe für den Staatshaushalt nicht mehr tragbar sind.
Dies führte ab 2014 zu jahrelangen Haushaltsdefiziten und einer Abnahme der Devisenreserven. Die öffentliche Verschuldung, sowohl die externe als auch die interne, stieg exponentiell an. Heute leiden die Bolivianer:innen, insbesondere diejenigen, die im Importgeschäft tätig sind, unter einem drastischen Devisenmangel, der zu einem Schwarzmarkt und hohem Abwertungs- und Inflationsdruck geführt hat.
Ein weiteres Element ist das beschleunigte Wachstum der Städte. Ein beträchtlicher Teil der städtischen Bevölkerung lebt unter prekären Bedingungen in den Metropolen und Städten oder migriert zur Pflanz- und Erntezeit in die landwirtschaftlichen Gebiete. Das verursacht eine Ausweitung der landwirtschaftlichen Grenzen des Landes und setzt die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen in städtischen und stadtnahen Gebieten unter Druck.
In diesem Kontext verfolgt die nationale Regierung eine zweideutige Umweltpolitik. Unter dem Vorwand, die Besiedlung grosser unbewohnter Gebiete zu fördern, erleichtert sie die Migration im Tiefland. Dabei fördert sie die Ausdehnung der landwirtschaftlichen Grenzen und die Zunahme der Produktion von Kokablättern – meist für den illegalen Gebrauch. Gleichzeitig greift die Regierung auf Brandrodungen zurück, um mehr Land für den Anbau zur Verfügung zu stellen, wodurch Fauna und Flora geschädigt werden. Abholzung und Waldbrände sind eine Konstante im Amazonas und im Chiquitano-Trockenwald. Zudem sind die nationalen Verpflichtungen beim Klimaschutz noch lange nicht erfüllt.
Derweil leidet die Regierungspartei (MAS - Movimiento al Socialismo) unter einem Zersetzungsprozess. Dem derzeitigen Präsidenten Luis Arce – dem ehemaligen Wirtschaftsminister von Evo Morales – ist es gelungen, einen grossen Teil der parteinahen Organisationen auf seine Seite zu ziehen. Evo Morales wiederum kontrolliert die wichtigsten regierungsfreundlichen Persönlichkeiten im Parlament und ist der derzeitige Vorsitzende der Partei sowie der wichtigste Anführer der Kokabäuerinnen und -bauern. Dieser Machtkampf hat zu Spaltungen in allen staatlichen Einrichtungen geführt und die öffentliche Verwaltung verlangsamt. Diese Entwicklung wird wohl bis zu den Wahlen im Jahr 2025 anhalten.
In diesem schwierigen Umfeld sind Chancen ein rares Gut, aber sie sind vorhanden und sollten genutzt werden. Die städtische Konzentration ist ein Motor für Innovation und Unternehmertum. Die Rolle des Privatsektors und der Wissenschaft kann für integrative sowie partizipative Entwicklungslösungen verstärkt werden. Die günstige Altersstruktur mit ihren vielen potenziellen Arbeitskräften ist beträchtlich und konzentriert sich auf mittelgrosse Städte und schnell wachsende Ballungsräume. Die ökologische Vielfalt, grosse Wälder und Gebirge bieten interessante Möglichkeiten.
Um die Chancen zu nutzen, sind Anstrengungen in der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, integrativer wirtschaftlicher Entwicklung, nachhaltiger Stadtentwicklung oder Abwasser- und Abfallwirtschaft nötig. Die internationale Zusammenarbeit muss diese Themen unterstützen und technische Begleitung leisten. Und schliesslich sind die Bürger:innen dafür verantwortlich, die Umsetzung der Entscheide und Massnahmen einzufordern. Dies kann dazu beitragen, dass die Bevölkerung, die aus der Armut herausgekommen ist, nicht wieder in Armut zurückfällt.

Martín del Castillo ist Wirtschaftswissenschaftler und Politologe mit Masterabschlüssen der Universitäten in Sucre, Bolivien, und Genf. Seit 2007 arbeitet er für Helvetas.
Artikel teilen
Global, Meinung
02.04.2024, Internationale Zusammenarbeit, Finanzen und Steuern
Ist Sparen wirklich das Gebot der Stunde? Ein umfassendes Umdenken ist dringend nötig, denn die Schuldenquote ist die beste Freundin der internationalen Zusammenarbeit. Dank ihr kann es sich die Schweiz mehr als leisten, die Kosten für die Ukrainehilfe ausserordentlich zu verbuchen und so die Entwicklungszusammenarbeit in den Ländern des Globalen Südens zu retten.

Andreas Missbach, Geschäftsleiter von Alliance Sud. © Daniel Rihs
Im Geschichtsstudium haben wir gelernt, dass der wissenschaftliche Fortschritt in den Fussnoten stattfindet. Erfreut habe ich kürzlich festgestellt, dass das auch für Bundesbern gilt. So weist die eidgenössische Finanzverwaltung in einer Fussnote zum Legislaturfinanzplan 23 – 27 auf die Diskrepanz zwischen dem internationalen Standard zur Nachhaltigkeit von Schulden und der Schweizer Praxis hin: Einerseits gibt es das Nachhaltigkeitskonzept, das «dem international von OECD, IWF und EU-Kommission anerkannten Standard (entspricht). Danach sind die öffentlichen Finanzen nachhaltig, wenn die Staatsschulden im Verhältnis zum BIP (Schuldenquote) auf einem ausreichend tiefen Niveau stabilisiert werden können. Die Schuldenbremse des Bundes ist restriktiver. Sie stabilisiert die Schulden des Bundes zu ihrem nominalen Wert in Franken.»
Auch in Franken waren die Schulden 2022 – trotz Corona – niedriger als 2002 bis 2008, als die Schweiz auch nicht gerade darnieder lag. Aber eben, entscheidend sind sowieso nicht die absoluten Schulden, sondern ihr Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt (man kann diesen Satz nicht oft genug sagen). Wie hoch ist denn diese Quote? Schauen wir nach in der jüngsten Ausgabe von «Grundlagen der Haushaltsführung des Bundes», einer Publikation der Finanzverwaltung, die sich an die Parlamentarier:innen richtet. 2022 betrug die Schuldenquote gemäss Maastricht-Definition der EU 26.2% und die Nettoschuldenquote, so wie sie der internationale Währungsfonds IWF berechnet, lag bei 15,3%. Gemäss Legislaturfinanzplan hingegen (der ein Monat nach den «Grundlagen» publiziert wurde) beträgt die Nettoschuldenquote aber 18,1%. Offensichtlich haben nicht nur das Verteidigungsdepartement und der Armeechef ein Problem mit den Zahlen (für 2023 liegt die Quote laut der Finanzministerin in der Frühlingssession bei 17,8%).
«Die Schuldenbremse ist meine beste Freundin», sagte Karin Keller-Sutter gegenüber der NZZ. Uns scheint allerdings eher, dass die Schuldenbremse Rumpelstilzchen ist: «Ach wie gut, dass niemand weiss …». Wobei – und auch diesen Satz kann man nicht oft genug wiederholen –, egal wie man die Schuldenquote der Schweiz misst, sie ist in jedem Fall im internationalen Vergleich lächerlich gering.
«Wiegt der Nutzen tiefer Schulden deren Kosten auf? Denn Schuldenabbau ist nicht gratis. Jeder Franken, der für Rückzahlung von Staatsschulden eingesetzt wird, ist ein Franken, der nicht für andere Staatsleistungen zur Verfügung steht», gibt Marius Brülhart, Volkswirtschaftsprofessor der Uni Lausanne, zu bedenken. Wo er das schreibt, ist ein Silberstreifen am Horizont, in der «Volkswirtschaft» nämlich, dem wirtschaftspolitischen Magazin des SECO. Bei Mitte-Präsident Gerhard Pfister, der sich für eine ausserordentliche Finanzierung der Ukraine-Kosten (Flüchtlinge und Wiederaufbau) ausspricht, ist das Thema angekommen. Ein umfassendes Umdenken ist dringend nötig, denn die Schuldenquote ist die beste Freundin der internationalen Zusammenarbeit. Dank ihr kann es sich die Schweiz mehr als leisten, die Kosten für die Ukrainehilfe ausserordentlich zu verbuchen und so die Entwicklungszusammenarbeit in den Ländern des Globalen Südens zu retten.
Wiegt der Nutzen tiefer Schulden deren Kosten auf? Denn Schuldenabbau ist nicht gratis. Jeder Franken, der für Rückzahlung von Staatsschulden eingesetzt wird, ist ein Franken, der nicht für andere Staatsleistungen zur Verfügung steht.
(Marius Brülhart)
Artikel teilen

global
Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.
Medienmitteilung
05.03.2024, Internationale Zusammenarbeit, Entwicklungsfinanzierung
Der Nationalrat hat heute den Vorstoss seiner Finanzkommission abgelehnt, der sichergestellt hätte, dass der Ukraine-Wiederaufbau nicht auf Kosten des Globalen Südens finanziert wird. Nun ist es an der Mitte, den Worten ihrer Stellungnahme zur internationalen Zusammenarbeit 2025-2028 auch Taten folgen zu lassen.

© Parlamentdienste, 3003 Bern / Monika Flückiger
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski trifft die Präsident:innen von Nationalrat und Ständerat bei seinem Besuch in der Schweiz im Januar 2024.
Gemäss Entwurf der Strategie für die internationale Zusammenarbeit (IZA) 2025-2028 will der Bundesrat in den nächsten vier Jahren mindestens 1,5 Milliarden Franken für die Ukraine verwenden. Die Vernehmlassung hat aber deutlich gezeigt, dass eine solidarische Unterstützung der Ukraine nicht auf Kosten anderer Schwerpunkte und Programme gehen darf. So fordert auch die Mitte in ihrer Vernehmlassungsantwort zur IZA-Strategie, «(d)ass die Mehrausgaben zugunsten der Ukraine separat ausgewiesen und beantragt werden», und «dass die Verpflichtungskredite der vorliegenden IZA-Strategie deswegen nicht gekürzt werden».
Ganz und gar unverständlich ist deshalb die heutige Ablehnung der Motion zur Schaffung eines Fonds für den Wiederaufbau der Ukraine (Mo. 23.4350). «Die Mitte hat es heute verpasst, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen: Sie muss nun bis zur Behandlung der Strategie in den Räten mehrheitsfähige Vorschläge für die Finanzierung des Ukraine-Wiederaufbaus ausserhalb der IZA ausarbeiten.», sagt Andreas Missbach, Geschäftsleiter von Alliance Sud, dem Schweizer Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik. Alles andere «(…) steht im Widerspruch zur humanitären Tradition der Schweiz und kann aus Sicht der Mitte nicht im langfristigen Interesse des Landes sein», wie sie selbst in ihrer Vernehmlassungsantwort schreibt.
Weitere Informationen:
Andreas Missbach, Geschäftsleiter Alliance Sud, Tel. 031 390 93 30, andreas.missbach@alliancesud.ch
Faktenblatt zum ausserordentlich finanzierten Wiederaufbau der Ukraine
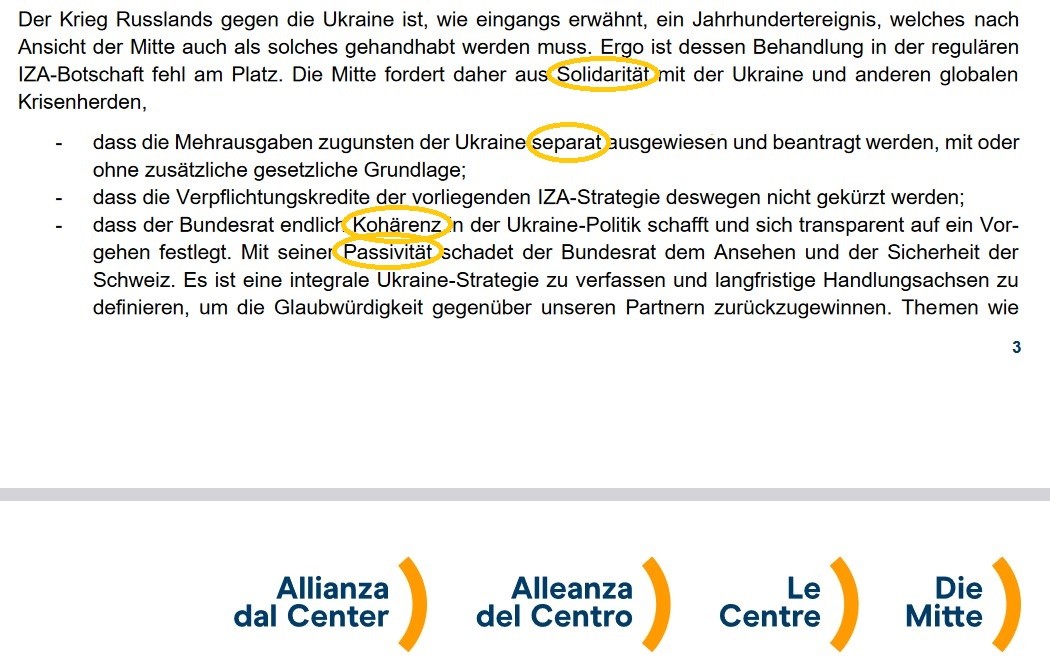
© Screenshot Alliance Sud, eigene Markierung
Die Mitte predigt in ihrer Vernehmlassungsantwort Solidarität und Kohärenz, setzt aber im Parlament auf Passivität wie der Bundesrat.
Artikel teilen
Artikel
23.03.2020, Internationale Zusammenarbeit
Die zentrale Rolle der Frauen für eine nachhaltige Entwicklung ist unbestritten. Selbst die Weltbank verfolgt eine Gender-Strategie. Doch gibt es eine richtige Strategie in einer falschen? Antworten von Genderforscherin Elisabeth Prügl.

global: Die Weltbank vermarktet sich seit einigen Jahren als Champion für Geschlechtergerechtigkeit. Wie kommt das?
Elisabeth Prügl: Geschlechtergerechtigkeit ist heute in der Tat ein zentrales Thema für die Weltbank – dafür gibt es mehrere Gründe. 2007 beschloss die Führung der Bank ernsthaft, eine Gender-Strategie zu implementieren, und anerkannte damit, dass Geschlechterverhältnisse für wirtschaftliche Entwicklungsprozesse relevant sind. Bis dahin war Geschlecht in erster Linie als sozialpolitisches Thema in der Erziehungs- und Gesundheitspolitik verhandelt worden, nun sollte es ein Thema der Wirtschaftspolitik werden. Das Argument dafür war, dass Geschlechtergerechtigkeit eine Sache des klugen Wirtschaftens sei («Gender Equality as Smart Economics»), Geschlechtergerechtigkeit soll also wirtschaftliches Wachstum unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat die Weltbank einige Forschungsprojekte und Datenerhebungen im Bereich Gender und Entwicklung finanziert, ein internes Gender-Monitoring von Projekten und Programmen eingeführt sowie die Zusammenarbeit auch mit Partnern aus dem Privatsektor gesucht. Nachdem die UNO in der Agenda 2030 der Geschlechtergerechtigkeit eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung gewidmet hat, schrieb die Bank 2016 eine neue Gender-Strategie, die auf ihrer eigenen, umfassenden Forschung aufbauen konnte. Und diese kam unter anderem zum Schluss, dass Management und Belegschaft mittlerweile bedeutend mehr Zeit in Genderthemen investierten. So ist die Weltbank zum Gender-Champion mutiert.
Die Weltbank ist mitverantwortlich dafür, dass heute fast alle der Meinung sind, ohne Privatsektor gebe es keine Entwicklung. Durch ihre Beratungsdienstleistungen und Darlehen propagiert sie in Entwicklungsländern Reformen, die auf Handelsöffnung, finanzielle Deregulierung und die Privatisierung von Infrastruktur und öffentlichen Dienstleistungen abzielen. Diese Privatisierungsagenda wird von feministischen Gruppierungen stark kritisiert. Warum?
Die Weltbank ist ein integraler Bestandteil der neoliberal geprägten Weltwirtschaftsordnung: Ihre Forschungsarbeiten, Projekte und Programme vertrauen unkritisch auf den Markt und basieren auf der Überzeugung, dass das Gemeinwohl am besten durch Marktanreize realisiert werde. Die zentralen Akteure in dieser Ideologie sind Privatpersonen und Firmen; und auch die staatliche Verwaltung soll sich an der Marktlogik orientieren.
Nun hat aber die Erfahrung der letzten 40 Jahre gezeigt, dass das uneingeschränkte Vertrauen in den freien Markt und die Privatwirtschaft extreme Ungleichheit geschaffen hat. Zudem zeigt eine freie Marktwirtschaft wenig Interesse an der Bereitstellung von zentralen Dienstleistungen, wie zum Beispiel der Pflege, der Erziehung oder des Gesundheitswesens – alles Bereiche, in denen Frauen überproportional beschäftigt sind, sei es als bezahlte, vor allem aber auch als unbezahlte Arbeitskräfte. Doch keine Gesellschaft, keine Wirtschaft kommt ohne diese Bereiche aus. Sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern hat die einseitige Bevorzugung des freien Marktes Krisen in den für die soziale Reproduktion und Pflege wichtigen Bereichen ausgelöst; und die Kosten dieser Krisen werden oftmals auf Frauen als unter- oder unbezahlte Arbeitskräfte abgewälzt. Das erklärt, dass viele Feministinnen dem neoliberalen Vertrauen auf den Markt und auf Privatisierung sehr kritisch gegenüber stehen.
Gender-Champion auf der einen Seite, Promotorin von Projekten und Politiken, die Frauen besonders schaden, auf der anderen. Wie bewerten Sie das Engagement der Weltbank im Bereich Geschlechtergerechtigkeit?
Die Weltbank tendiert dazu, Frauen für die Entwicklung zu instrumentalisieren: Geschlechtergerechtigkeit wird in erster Linie als wichtiger Faktor für wirtschaftliches Wachstum und Armutsbekämpfung dargestellt. Frauen sind in den Empfehlungen der Weltbank abstrakte Subjekte, die in die existierende Wirtschaftsordnung integriert werden müssen. Aber die Bank ist kein Monolith; innerhalb der Organisation findet man diverse Vorstellungen, auch voneinander abweichende feministische Auffassungen. Einige dieser Ideen haben Eingang in die neue Gender-Strategie der Bank gefunden. So beinhaltet die Strategie neben herkömmlichen Vorschlägen, wie einem besseren Zugang für Frauen zur Arbeitswelt, auch eher unorthodoxe Anregungen wie zum Beispiel bessere Kinderversorgung und Pflege sowie Massnahmen gegen häusliche Gewalt. Wenn diese Ziele als zentral für die Beteiligung von Frauen in der Wirtschaft anerkannt werden, verändert sich auch das Verständnis von wirtschaftlicher Entwicklung. Und obwohl die Gender-Strategie der Bank orthodoxe, makro-ökonomische Modelle nach wie vor nicht prinzipiell hinterfragt, beginnt sie diese Modelle immerhin zu erweitern. Kurz, dem Ansatz der Weltbank stehe ich kritisch gegenüber, aber ihr Interesse an der Geschlechtergerechtigkeit bewerte ich positiv.
In welchen Punkten muss sich die Weltbank verbessern, um dem Ziel der Geschlechtergerechtigkeit näher zu kommen?
Zwei Interventionen sind meines Erachtens zentral: Erstens hat die Weltbank in den letzten Jahren wichtige Forschungsarbeiten geliefert, um die zentrale Rolle von Frauen und von geschlechtsspezifischen Praktiken in der wirtschaftlichen Entwicklung sichtbar zu machen. Diese Forschung hat grossen Einfluss. Feministische Wirtschaftstheorien kommen in diesen Arbeiten jedoch oft zu kurz. Die Weltbank muss feministischen Ansätzen mehr Aufmerksamkeit schenken. Die Zusammenarbeit mit UN Women bietet dazu ausgezeichnete Möglichkeiten.
Zweitens gibt es nach wie vor Schwachpunkte in der Implementierung ihres Geschlechteransatzes. Für die Genderarbeit stehen relativ wenig finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Diese Arbeit kann nicht an Firmen delegiert werden, die in der Regel über wenig Genderexpertise verfügen und meinen, mit einer Erhöhung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen sei es getan; auch braucht es mehr als bloss Unternehmertrainings für Frauen. Geschlechtergerechtigkeit funktioniert nur, wenn sie auf einem grundlegenden Verständnis basiert, wie sich das Geschlecht in Gesellschaft und Wirtschaft im Zusammenklang mit anderen sozialen Differenzen, insbesondere der sozialen Klasse, auswirkt.
Elisabeth Prügl - Genderforscherin am IHEID
Elisabeth Prügl leitet am Graduate Institute für Internationale und Entwicklungsstudien (IHEID) in Genf das Gender Centre. Schwerpunkt ihrer Lehre und Forschung in den USA und der Schweiz ist Gender-Politik in der internationalen Regierungsführung. 2019 erhielt sie den «Eminent Scholar Award» der International Studies Association (ISA) im Bereich feministische Theorie und Gender Studies.
Artikel teilen
Artikel
11.05.2020, Internationale Zusammenarbeit, Entwicklungsfinanzierung
Trotz gegenteiliger Beteuerungen bleibt die Politik der Weltbank namentlich in Sachen Menschenrechte und Klima hochproblematisch. Macht die Schweiz bei den Kapitalerhöhungen mit, muss sie ihren Einfluss für eine Kursänderung geltend machen.

Die Weltbank-Kapitalerhöhungen aus entwicklungspolitischer Sicht: Die Position von Alliance Sud
Trotz gegenteiliger Beteuerungen bleibt die Politik der Weltbank namentlich in Sachen Menschenrechte und Klima hochproblematisch.
Die Schweiz muss ihren Einfluss für eine Kursänderung geltend machen.
Artikel teilen
Artikel
22.06.2020, Internationale Zusammenarbeit
Das neoliberal geprägte Entwicklungsmodell hat jahrzehntelang die Unterdrückung der Menschenrechte in Kauf genommen. Zeit für einen Paradigmenwechsel.

Allein 2019 wurden laut dem Business and Human Rights Center im Kontext von Firmenaktivitäten 572 Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger und Umweltaktivistinnen verzeichnet, rund ein Drittel davon betraf Frauen. Die Übergriffe reichten von fristloser Kündigung – wie etwa in Bangladesch, als 12 000 Textilarbeiterinnen nach Protesten entlassen wurden – bis hin zu Einschüchterung, polizeilicher Gewalt und Mord. In den allermeisten Fällen hat diese Repression für die Täter keine Folgen, da Regierung und Firmen im Namen der «Entwicklung» zusammenspannen. Menschen, die sich gegen Landraub, die Vergiftung von Flüssen oder die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen wehren, werden von Regierungen und den betroffenen Firmen oft pauschal als «Feinde der Entwicklung» bezeichnet.
Häufig sind Entwicklungsbanken in die Finanzierung solcher Aktivitäten verwickelt. Ein 2019 publizierter Bericht der Coalition for Human Rights in Development analysiert die Rolle von Entwicklungsbanken in 25 Infrastruktur- und Entwicklungsprojekten, die mit massiver Repression einhergingen. Elf der analysierten Projekte beinhalteten Finanzierung durch die International Finance Corporation (IFC), sechs wurden von anderen Weltbankunterorganisationen finanziert. Die Fallstudien beinhalten u.a. die polizeiliche Niederschlagung eines Streiks in Südafrika gegen ein von der IFC finanziertes Bergbauunternehmen im Jahr 2012, bekannt als Massaker von Marikana, bei dem 34 Menschen getötet wurden und das als die blutigste Gewaltanwendung einer südafrikanischen Regierung seit 1960 gilt; die Ermordung von Gloria Capitan im Jahr 2016, die sich gegen die intensive Luftverschmutzung wehrte, welche durch die IFC finanzierte Kohleprojekte auf den Philippinen verursacht wurde, und die Inhaftierung von Pastor Omot Agwa, der die indigenen Anuak in Äthiopien bei ihrer Beschwerde wegen Vertreibung gegen die Weltbank unterstützt hatte. Der Bericht kommt zum Schluss, dass die Entwicklungsbanken meist nichts gegen die Repression unternehmen, die mit von ihnen finanzierten Projekten einhergeht. Reaktionen kommen zu spät und gehen zu wenig weit, betroffene AktivistInnen erhalten selten Schadensersatz und bleiben weiterer Repression schutzlos ausgeliefert. Oft werden Regierungen und Firmen, die in Menschenrechtsverletzungen involviert sind, von den Entwicklungsbanken weiter finanziert, selbst nachdem Unterdrückungs- und Vergeltungsmassnahmen publik geworden sind.
In den letzten Jahren wurden die Rechte der Zivilgesellschaft in vielen Ländern weiter eingeschränkt, so dass es für AktivistInnen immer schwieriger und gefährlicher wird, sich gegen die Politik ihrer Regierung oder gegen vermeintliche Entwicklungsprojekte zu wehren. Die Massnahmen zur Bekämpfung der aktuellen Corona-Pandemie verschärfen diesen Trend in vielen Ländern noch zusätzlich. Umso wichtiger ist es darum, dass Firmen, Investoren und Entwicklungsbanken diesem Trend entgegenwirken und bei ihren Projekten die betroffene Bevölkerung von Anfang an mit einbeziehen und sich klar für den Schutz der Menschenrechte einsetzen. Immerhin: Im März 2020 hat sich eine Gruppe von 176 internationalen Investoren mit einem verwalteten Vermögen von über 4,5 Billionen US-Dollar in einem offenen Brief an die 95 Unternehmen mit den schlechtesten Ergebnissen bei der Sorgfaltspflicht im Bereich Menschenrechte gewandt und sie dazu angehalten, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Die Weltbank hat parallel dazu ein Statement gegen Vergeltungsmassnahmen veröffentlicht.
Schöne Worte allein genügen aber nicht. Der Begriff der Entwicklung muss kritisch diskutiert, alternative Entwicklungsmodelle, die vom neoliberalen, ressourcenintensiven Wachstumsmodell abweichen, müssen zugelassen werden. Als Ausgangspunkt kann die UN-Agenda 2030 dienen. Sie bietet eine holistische Vision von Entwicklung, nach der alle – die reichen und die ärmeren Länder – angehalten sind, Ungleichheit zu reduzieren und ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu fördern; und gemäss dem Prinzip Leave no-one behind sollen die Bedürfnisse der Ärmsten und marginalisiertesten Bevölkerungsschichten im Zentrum von Entwicklung stehen.
Eine kurze Geschichte der «Entwicklung»
kl. 1949 sprach der US-amerikanische Präsident Harry S. Truman das erste Mal in einer Ansprache an die Nation davon, dass die reichen «entwickelten» Nationen ihren Fortschritt nutzen müssten, um den ärmeren «unterentwickelten» Ländern bei ihrer Entwicklung beizustehen. Es ist die Geburtsstunde eines linearen, entpolitisierten und durch und durch kapitalistischen Bilds von Entwicklung. Demgemäss ist der Westen dank harter Arbeit, Fleiss und Innovation den armen Ländern auf dem Pfad der Entwicklung ein paar Schritte voraus. Sklaverei, Imperialismus und Kolonialismus, die diesen «Entwicklungsfortschritt» bedingten, bleiben ausgeblendet. Nun sei es an den ärmeren Ländern, die richtigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und sich mit der grosszügigen Hilfe der reicheren Nationen deren Lebensstandard anzunähern. Die vom Westen propagierten entwicklungspolitischen Rahmenbedingungen waren allerdings von Anfang an darauf angelegt, westlichen Firmen und Regierungen den Zugang zu den unentbehrlichen Rohstoffen und Ressourcen der ärmeren Länder offenzuhalten; auch war die sogenannte «Entwicklungshilfe» meist an Bedingungen geknüpft, die den westlichen Firmen einen Absatzmarkt in den ärmeren Ländern garantierten, für diese gebundene Hilfe hat sich der Begriff tied aid durchgesetzt.
Heutzutage konkurrieren verschiedene Konzepte von Entwicklung miteinander und die Entwicklungshilfe hat sich massiv verändert. Sie hat sich grösstenteils vom tied aid-Prinzip abgewandt und setzt vermehrt auf Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung, daher die Bezeichnung Entwicklungszusammenarbeit (kurz EZA), die sich im breiten Sprachgebrauch allerdings nie auf ganzer Linie durchzusetzen vermochte.
Das dominierende Modell von Entwicklung, das von den meisten Regierungen und einflussreichen internationalen Institutionen – allen voran der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds – propagiert wird, basiert jedoch nach wie vor auf dem Anlocken von ausländischen Direktinvestitionen und Handelsliberalisierung, die zum obersten Ziel – dem Wirtschaftswachstum – führen sollen. Den Entwicklungsländern wird dabei «geholfen», Investoren anzulocken, die sich in gross dimensionierten Infrastruktur-, Landwirtschafts- und Energieprojekten engagieren, die häufig primär der Exportförderung dienen. Die Regierungen ihrerseits verpflichten sich, protektionistische Handelsregulierungen abzubauen, die Privatisierung voranzutreiben und den Investoren Land und Ressourcen zu guten Konditionen zur Verfügung zu stellen. Oftmals sind es dann auch regierungsnahe Kreise, die durch die weitverbreitete Korruption am meisten von der Präsenz ausländischer Investoren profitieren und gerne ein Auge zudrücken, wenn es um den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt geht.
Artikel teilen