Artikel teilen

global
Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.
Wirtschaftsgeschichte
25.03.2024, Handel und Investitionen
Vor 80 Jahren legten 43 Länder im US-Kurort Bretton Woods die Grundlage für den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank. Oft wird der Konferenz überhöht die ganze Nachkriegsordnung zugeschrieben. Ein neu erschienenes Buch rückt die Perspektiven zurecht.

Der US-amerikanische Finanzminister Fred M. Vinson unterschreibt am 27. Dezember 1947 in Washington, USA, die in Bretton Woods beschlossenen Abkommen. © KEYSTONE / DPA DC /STR
Wenn es ächzt und knirscht im Gebälk der Weltwirtschaft, ist der Ruf nicht weit nach einer «Art Bretton Woods wie nach dem Zweiten Weltkrieg», so stellvertretend Klaus Schwab nach der Corona-Krise. Ein neu erschienenes Buch des Wirtschaftshistorikers Martin Daunton «The Economic Government of the World, 1933 – 2023» erlaubt es, die Bedeutung der Bretton-Woods-Konferenz ins richtige Licht zu rücken.
Der Autor zeigt, dass 1944 nicht eine kohärente Architektur gefunden wurde, die nach dem Krieg nur noch umgesetzt werden musste, um so das Nachkriegs-Wirtschaftswunder loszutreten. Vielmehr wurde dort lediglich ein Suchprozess in Gang gesetzt. Die Nachkriegsordnung wurde noch von ganz anderen Kräften geprägt: Dem Kalten Krieg (in Bretton Woods war die Sowjetunion noch als vollwertige Partnerin vorgesehen gewesen), dem damit verbundenen Marshall-Plan und der ebenfalls damit verbundenen Wiederherstellung der wirtschaftlichen Stellung Deutschlands in Europa. Das System der flexibel an den Dollar gebundenen Währungen, der wiederum einen fixen Wechselkurs zu Gold hatte, funktionierte gar nur von 1958 – 1968 so wie in Bretton Woods vorgesehen.
Innerhalb der US-Regierung von Franklin D. Roosevelt, dem demokratischen Präsidenten von 1933 bis 1945, gab es eine Fraktion, die den New Deal auch international dachte. Schon Anfang der 40er Jahre schmiedete sie Pläne für eine öffentliche interamerikanische Entwicklungsbank, die Banker der Wall Street entmachten sollte und auf langfristige öffentliche Entwicklungsfinanzierung statt auf private Investitionen setzte. Der Zuständige für Lateinamerika im US-Aussenministerium sagte 1940, dies sollte der Beginn eines Systems sein, in dem «das Finanzwesen im Dienst des Austauschs und der Entwicklung steht (...) in direktem Gegensatz zum früheren System, das auf der Auffassung basierte, dass die Entwicklung und der Handel dem Finanzwesen dienen müssen». Der Widerstand der Wall Street und im Kongress setzte diesen Plänen allerdings vorerst ein Ende, das Thema war aber mit den Diskussionen über eine International Bank for Reconstruction and Development (IBRD, bis heute der offizielle Name der Weltbank) in Bretton Woods gesetzt.
Die Bretton-Woods-Konferenz wurde von den USA und Grossbritannien dominiert und zu einem beträchtlichen Teil schon vorverhandelt. Die Länder des Globalen Südens – soweit schon unabhängig (wie in Lateinamerika) oder teilautonom (wie Indien) – waren aber auch vertreten. Ebenso hatte Australien als damals noch ganz von Rohstoffexporten abhängiges Land dieselben Anliegen. Für ihre Prioritäten war die Konferenz zur Währungs- und Finanzordnung aber nicht das einzige Forum. Bereits 1943 gab es eine Konferenz zu Nahrungsmitteln und Landwirtschaft und im Jahr darauf eine zu Arbeit, an der Australien erfolglos versuchte, Vollbeschäftigung neben Währungs- und Handelsfragen als gleichwertigen Pfeiler der Nachkriegsordnung zu etablieren.
Auf den harten Kern eines internationalen Währungsfonds, der es erlauben sollte, die Währungen der Mitglieder an den Dollar zu binden, der wiederum zu einem fixen Kurs an Gold gebunden war, hatten sich die USA und Grossbritannien bereits geeinigt. Damit sollte eine Stabilität des Währungssystems mit Flexibilität kombiniert werden, die es den Ländern mit Handelsbilanzdefiziten erlauben sollte, ihre Währungen kontrolliert abzuwerten und so Austerität und Arbeitslosigkeit zu verhindern. Flankiert wurde dies von Kapitalverkehrskontrollen, die die Länder vor destabilisierenden Kapitalflüssen schützten. Der US-Verhandlungsführer in Bretton Woods, Harry Dexter White (sein britisches Gegenüber war der Ökonom John Maynard Keynes, dessen wirtschaftspolitischem Denken, dem «Keynesianismus», später die ganze Nachkriegsordnung zugeschrieben wurde) schrieb in einem frühen Entwurf zur Währungsordnung, dass Länder Kapitalflüsse verhindern sollten, die Instrumente der Reichen seien, um «neue Steuern oder Sozialabgaben» zu umgehen.
«The Economic Government of the World, 1933–1923» (Verlag Farrar, Straus and Giroux, erschienen im November 2023, 986 Seiten) führt hinter die Kulissen der Institutionen, die in den letzten neunzig Jahren die Weltwirtschaft geprägt haben. Es ist in der Schweiz im Online-Buchhandel erhältlich (auf Englisch).
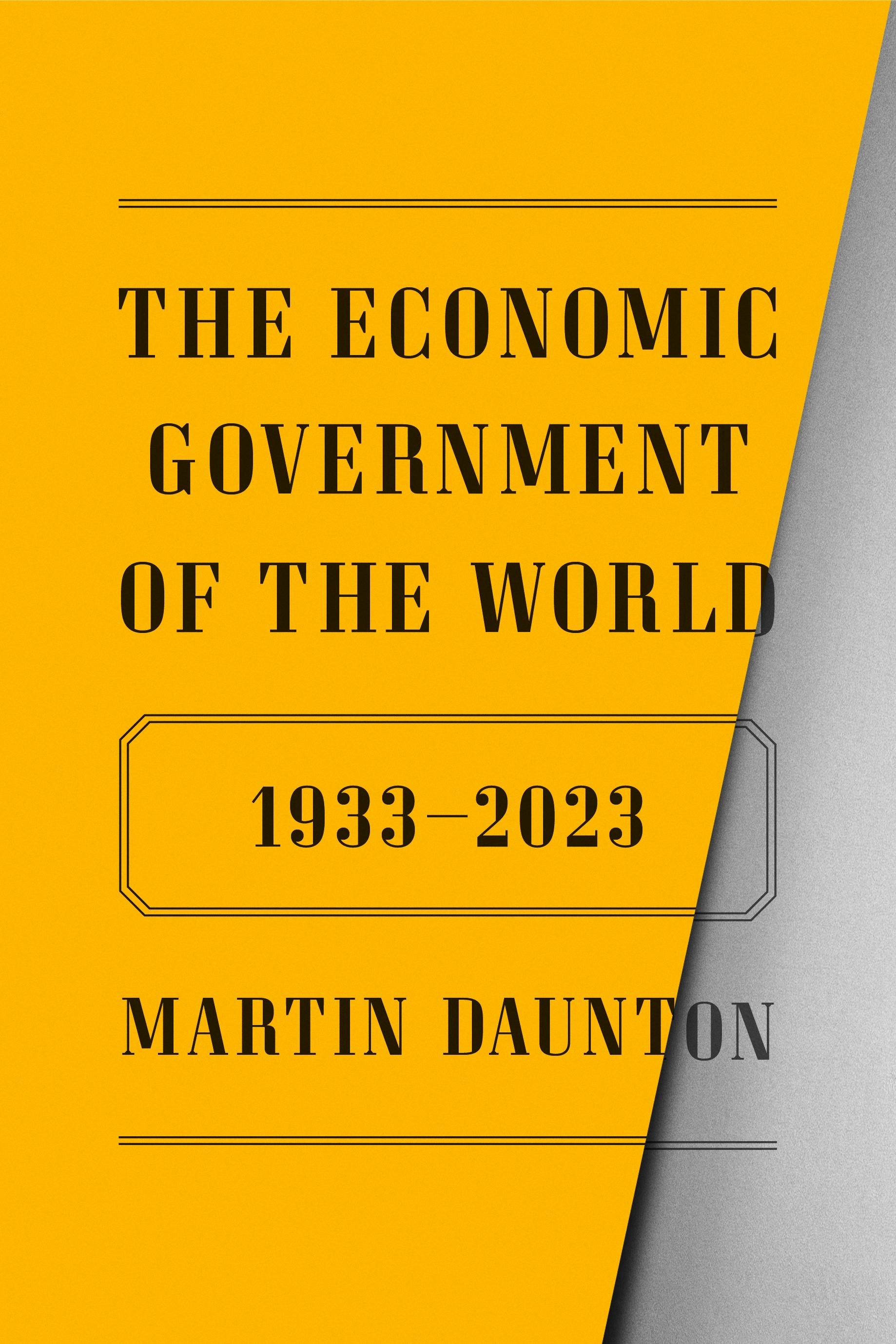
Die USA und Grossbritannien schlugen auch ein Entscheidungsmodell vor, das nach dem Prinzip «one dollar, one vote» an die in den Fonds einbezahlten Gelder gebunden war. So erhielt Grossbritannien ein Übergewicht und die USA eine Vetomöglichkeit. China und Indien, unterstützt von Australien, den lateinamerikanischen Ländern und Frankreich, protestierten erfolglos dagegen. Diese Quotenfrage – die angesichts der veränderten Gewichte in der Weltwirtschaft umso dringender geworden ist – wurde bis heute nicht gelöst.
Lateinamerika war mit 19 Delegationen nach Bretton Woods gereist. Ihre Wortführer betonten die besonderen Probleme mit der Handelsbilanz für Länder, die vom Export von Rohstoffen abhängig sind. Ihnen ging es nicht primär um Währungsfragen, sondern vor allem um die stark schwankenden Preise von mineralischen und agrarischen Rohstoffen. Entsprechend versuchten diese Länder das Mandat des Internationalen Währungsfonds (IWF) um Entwicklungsfragen zu ergänzen: Sie forderten Rohstoffabkommen zur Stabilisierung der Preise und die Möglichkeit, eine eigene Industrie zu fördern und zu schützen, um die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren. Grösstenteils erfolglos, die «Articles of Agreement» des IWF enthalten zwar ein Bekenntnis zu Entwicklung, umgesetzt werden sollte das aber von der IBRD, also der Weltbank.
In der Einladung zur Bretton-Woods-Konferenz hatte der Währungsfonds, bei dem «definite proposals» angestrebt wurden, klar Priorität vor einer Bank für den Wiederaufbau. Zentrale Fragen zur Diskussion über die IBRD waren aber für die Delegationen aus dem Globalen Süden hoch relevant. Eine drehte sich darum, ob die Bank primär private Investitionen garantieren oder eigenständig Kredite vergeben sollte. Grossbritannien und die Vertreter der Wall Street wollten eine Bank, die primär private Transaktionen koordiniert und absichert. Dies erstaunt nicht, Grossbritannien war immer noch das wichtigste Finanzzentrum – auch nach dem Krieg wurden 70% der globalen Finanztransaktionen in Sterling abgewickelt –, bevor die Wall Street die Londoner City überholte. Eine zweite Frage drehte sich um das Verhältnis zwischen «Reconstruction» (Wiederaufbau) und «Development» (Entwicklung) im Mandat der Bank. Schliesslich ging es um die damit verbundene Frage, ob die Bank auch Kredite vergeben durfte, die keinen direkten wirtschaftlichen Ertrag abwerfen. Also etwa strukturelle Abwasser- oder Gesundheitsprogramme, die langfristig die Produktivität eines Landes stärken, oder nur konkrete, auch kommerziell interessante Projekte wie etwa ein Kraftwerk. Wer die aktuelle Diskussion über die Weltbank verfolgt, kann sich auch nach 80 Jahren ein «sounds familiar» nicht verkneifen.
Das Ergebnis war ein Kompromiss, der Wiederaufbau und Entwicklung der Mitglieder der IBRD auf die gleiche Stufe stellte. Bei den anderen Fragen gab es allerdings kaum Flexibilität. Nur 20% des Kapitals konnten direkt als Kredite vergeben werden (der Rest war für die Absicherung von privaten Investitionen vorgesehen) und dies ausser in (nicht definierten) Ausnahmefällen nur für spezifische Projekte mit einem «produktiven Zweck».
Während 1944 nur über den Währungsfonds und die Weltbank diskutiert und entschieden wurde, war aber von Anfang an eine internationale Handelsorganisation als dritter Pfeiler der Weltwirtschaftsordnung vorgesehen. Auch hier wollte man Zustände wie in der Zwischenkriegszeit verhindern, als sich Länder hinter hohen Zollmauern verschanzten und Handelskriege führten (Daunton setzt seinem Buch ein Zitat von Donald Trump voran: «Trade wars are easy to win»).
Nach den Enttäuschungen in Bretton Woods setzten die Länder des Globalen Südens, jetzt gestärkt durch die Unabhängigkeit des indischen Subkontinents, ihre Hoffnungen auf die Verhandlungen über die «International Trade Organisation» (ITO). Diese fanden 1947 in Genf und 1948 in Havanna statt. An der Havanna-Konferenz stellten die wenig industrialisierten «Entwicklungsländer» eine Mehrheit. Die Konferenz wurde vom Marshall-Plan überschattet; viele Länder des Globalen Südens hofften oder erwarteten, auch in den Genuss von Hilfe zu diesen Konditionen zu kommen. Zunehmend wurde ihnen aber klar, dass dies wohl nicht der Fall sein würde (auch wenn die offizielle Absage der USA erst nach der Konferenz kam). Unter der Führung lateinamerikanischer Länder und Indien nutzten die «Entwicklungsländer» ihre Mehrheit an der Havanna-Konferenz und verschärften die ITO-Charta mit ihren gescheiterten Forderungen aus Bretton Woods: einer Beschränkung des Freihandels, um eigene Industrien aufzubauen, Vorzugszölle und Rohstoffabkommen. Und in der ITO sollte das Prinzip «one country, one vote» gelten.

Martin Daunton ist emeritierter Professor für Wirtschaftsgeschichte an der University of Cambridge. Zurzeit ist er Gastprofessor beim Gresham College in London.
Gewonnen war damit aber nichts, denn im Dezember 1950 entschied US-Präsident Truman, das Abkommen nicht dem Kongress zu unterbreiten. Die meisten anderen Industrieländer hatten ihre Zustimmung von den USA abhängig gemacht; und so starb die ITO Anfang der 50er Jahre einen stillen Tod. Übrig blieb das bereits 1947 verhandelte allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), das graduelle Zollsenkungen vorsah. Erst 1994 wurde unter ganz anderen Vorzeichen und nach siebenjährigen Verhandlungen mit der Gründung der Welthandelsorganisation WTO die Architektur so vervollständigt, wie es ursprünglich geplant war.
Die wirtschaftliche Nachkriegsordnung wurde von John Ruggie (dem späteren UN-Sonderbeauftragten für Unternehmen und Menschenrechte) als «embedded liberalism» bezeichnet. Für die Länder des Globalen Südens bedeutete diese Einbettung, so Martin Daunton, «eine spezifische Form des Neokolonialismus und eine globale Wirtschaft, die auf den Interessen der fortgeschrittenen Industrieländer beruht».
Ihre Forderungen lösten sich aber nicht einfach in Luft auf; sie wurden ab den Sechzigerjahren in der UNO wieder aufgenommen. Die De-Kolonisierung hatte deren Kreis der Mitglieder verändert; allein 1960 traten 16 afrikanische Länder der UNO bei. 1964 fand die erste United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) in Genf statt. In den 70er Jahren stand die Diskussion über «Economic Government of the World» unter dem Zeichen einer Neuen Weltwirtschaftsordnung (New International Economic Order), die der Süden auf die Agenda gesetzt hatte. Nach jahrelangen Verhandlungen versenkten Ronald Reagan und die lateinamerikanische Schuldenkrise in den Achtzigerjahren auch diesen Anlauf ergebnislos.
Viele der strukturellen Probleme, die der Süden in Bretton Woods aufgebracht hatte, sind bis heute ungelöst. Deshalb macht der Verweis auf diese Konferenz auch nach der Lektüre des Buches von Martin Daunton, das die Bedeutung der Konferenz relativiert, trotzdem Sinn. Dann nämlich, wenn er genau auf diesen Aspekt fokussiert, so wie das UNO-Generalsekretär António Guterres 2023 in der UNO-Generalversammlung sagte: «It is time for a new Bretton Woods moment. A new commitment to place the dramatic needs of developing countries at the centre of every decision and mechanism of the global financial system.»
Artikel teilen

global
Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.
Artikel
12.03.2024, Handel und Investitionen
Das Freihandelsabkommen mit Indien, das am 10. März in Delhi unterzeichnet wurde, verspricht massive Investitionen in Indien und die Schaffung von einer Million Arbeitsplätzen. Aus entwicklungspolitischer Sicht handelt es sich um einen begrüssenswerten Schritt, doch die Nachhaltigkeit hätte stärker verankert werden müssen.

Die Maschinenindustrie freut sich über den zollfreien Handel. Fraglich ist, ob auch die Menschen davon profitieren werden.
© Keystone
Indien ist ein besonders herausfordernder Verhandlungspartner. Dies bekamen die Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) zu spüren, zumal sie bereits seit 2008 über ein Freihandelsabkommen mit Delhi verhandelten. Hauptstreitpunkt war die Stärkung der geistigen Eigentumsrechte an Arzneimitteln (im Fachjargon TRIPS+ genannt, da sie über das TRIPS-Abkommen der WTO hinausgeht). Diese wurde von der Schweiz nachdrücklich gefordert, von Indien, dem weltweit grössten Hersteller von Generika, jedoch abgelehnt.
Am 10. März verkündete die EFTA in Delhi die Unterzeichnung des Abkommens und landete damit einen Coup: Im Schlussspurt überholte sie die in endlose Verhandlungen verstrickte Europäische Union und andere Partner wie das Vereinigte Königreich. Die Botschaft kam nicht völlig überraschend, da Bundesrat Guy Parmelin den Abschluss der Verhandlungen bereits einige Wochen zuvor kommuniziert hatte; der Inhalt des Textes blieb jedoch noch unter Verschluss. Alliance Sud und andere NGOs befürchteten, Indien könnte dem Druck der Schweizer Pharmaindustrie nachgegeben haben; dies bezüglich problematischer Bestimmungen zur Datenexklusivität oder der Verlängerung der Patentlaufzeit, was die Herstellung und Markteinführung von Generika verzögert und verteuert hätte.
Der am Sonntag veröffentlichte Text zeigt jedoch, dass Indien, auch dank der Unterstützung der internationalen Zivilgesellschaft, in dieser Hinsicht nicht nachgelassen hat. Zumindest vorerst, denn die Parteien werden ein Jahr nach Inkrafttreten des Abkommens weiter über die Datenexklusivität diskutieren. Andere problematische Bestimmungen untergraben die im TRIPS-Übereinkommen der WTO enthaltenen Flexibilitäten, insbesondere die Möglichkeit, im Voraus Einsprache gegen die Erteilung eines Patents zu erheben.
Der Text enthält noch eine weitere Überraschung: Die EFTA-Länder verpflichten sich, in den nächsten 15 Jahren 100 Milliarden USD in Indien zu investieren und 1 Million Arbeitsplätze zu schaffen. Mit anderen Worten: Delhi will nicht nur zollfrei Maschinen, Uhren und chemische sowie pharmazeutische Produkte importieren, sondern auch vor Ort Wertschöpfung schaffen.
Auch wenn es schwer vorstellbar ist, wie die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein ihre Industrie konkret dazu bringen können, in Indien zu investieren, ist diese Bestimmung – ein Novum in einem Schweizer Freihandelsabkommen – aus entwicklungspolitischer Sicht ein Schritt nach vorn.
Es ist auch vorgesehen, dass Investitionen insbesondere in Sektoren getätigt werden, die mit regionalen und internationalen Wertschöpfungsketten verbunden sind. Bei genauerem Hinsehen sind die Parteien jedoch nicht viele Risiken eingegangen: Der Technologietransfer, das alte und umstrittene Schlagwort der Nord-Süd-Beziehungen, wird nicht vorausgesetzt; der Text beschränkt sich darauf, von «technologischer Zusammenarbeit» zu sprechen.
Die Berufsausbildung wird ebenso gefördert wie die Partnerschaft zwischen Kompetenzzentren und Forschungsinstituten in hoch entwickelten Bereichen wie Geowissenschaften, Telemedizin, Biotechnologie, Digitaltechnologie, MINT-Disziplinen (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik), sowie erneuerbare Energien und saubere Technologien. Auch vorgesehen sind joint ventures zwischen Unternehmen aller Grössen, einschliesslich KMUs, was wiederum zu begrüssen ist, da Indien (und die Schweiz) viele davon zählt.
Um die Umsetzung des Investitionskapitels zu begleiten, wird ein Unterausschuss eingesetzt. Aber dieses Kapitel unterliegt im Gegensatz zum Rest des Abkommens (mit Ausnahme des Kapitels über nachhaltige Entwicklung) nicht dem Streitbeilegungsmechanismus. Die Parteien ziehen es vor, Streitigkeiten durch Konsultationen beizulegen, wohl um sich einen gewissen Handlungsspielraum zu erhalten.
Die neuen Bestimmungen dürften die schweizerischen Hochschulen, Forschungszentren, Unternehmen und Start-ups erfreuen, doch aus entwicklungspolitischer Sicht ist das Fehlen verbindlicher Sozial- und Umweltstandards zu beklagen. Denn eine zentrale Frage bleibt offen: Wird ein Schweizer Unternehmen, das in Indien eine Zementfabrik oder eine Kohlemine eröffnen möchte, auch vom Unterausschuss für Investitionen begleitet, und werden dessen Investitionen auch zu den 100 Milliarden USD gezählt? Leider ist das zu befürchten. Bedauerlicherweise hat Indien nicht mehr Bedingungen gestellt, obwohl das Land sehr klare Vorstellungen davon hat, welche ausländischen Unternehmen sich in seinem Hoheitsgebiet ansiedeln sollen, und sich auch nicht an der von China in der WTO vorangetriebenen Initiative zur Erleichterung von Investitionen beteiligt.
Dies gilt umso mehr, als das Kapitel über nachhaltige Entwicklung zwar verbindlich ist, aber nicht dem Streitbeilegungsmechanismus unterliegt. Die Einhaltung der Menschenrechte und die von den Parteien ratifizierten ILO-Kernarbeitsnormen werden zwar angemahnt, aber unterstrichen, dass die nationalen Gesetze gelten. So dürfen Gewerkschaftsrechte und Umweltstandards nicht «zu protektionistischen Zwecken» genutzt und die komparativen Vorteile beider Seiten müssen respektiert werden – im Fall Indiens bedeutet dies billige Arbeitskräfte, die nur einen relativen Schutz geniessen, und laxere Umweltstandards.
Obwohl dieses Freihandelsabkommen einen Schritt in die richtige Richtung darstellt, hätte es aus sozialer und ökologischer Sicht ambitionierter sein können anstatt sich auf Wünsche und gute Absichten zu beschränken. Alliance Sud bedauert zudem, dass vor Abschluss dieses Abkommens keine Ex-ante-Folgenabschätzung zur nachhaltigen Entwicklung durchgeführt worden ist.
Artikel teilen
Kommentar
02.03.2024, Handel und Investitionen
Am Freitagabend endete in Abu Dhabi die 13. Minister:innenkonferenz der WTO, ohne ein substanzielles Resultat zu erzielen. Lediglich zwei Moratorien wurden verlängert, darunter das zu elektronischen Übertragungen. Während sich China zur neuen Vorkämpferin einer Globalisierung neoliberaler Prägung entwickelt hat, halten sich die USA im Hintergrund. Derweil hat die Schweiz eine neue Verbündete, die mit Vorsicht zu behandeln ist.

© Alliance Sud / Isolda Agazzi
Nach mehrmaliger Verlängerung ging die 13. Minister:innenkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) in Abu Dhabi am späten Freitagabend zu Ende. Die Ausbeute ist mager: Die Mitgliedstaaten – inzwischen 166, nachdem an der Konferenz die Komoren und Osttimor beigetreten sind – schafften es bei kaum einem Thema, sich zu einigen.
In einer zunehmend fragmentierten Welt, lange von einem traditionellen Nord-Süd-Graben, aber seit geraumer Zeit auch durch wachsende Bruchlinien im Süden geprägt, will es der WTO nicht mehr gelingen, nach Konsensprinzip Entscheide zu fällen, so wie es ihre Statuten vorsehen. Aber auch unzählige plurilaterale Abkommen fanden im Plenum kein Gehör, da es die Mitglieder verpassten, deren Integration in die WTO in Betracht zu ziehen.
Am weitesten fortgeschritten war das 2017 in Buenos Aires initiierte und mittlerweile 124 Mitglieder umfassende Abkommen zur Erleichterung von Investitionen in Entwicklungsländern. Gefördert wurde es von China, mit Unterstützung von Ländern des Nordens sowie des Südens, jedoch nicht der USA, während die Europäische Union und die Schweiz an Bord waren. Aus Entwicklungsperspektive enthält das Abkommen hoch problematische Bestimmungen, obwohl es vorgibt, ebendiese Entwicklung voranzubringen.
So ermöglicht unter anderem eine Bestimmung zur «Transparenz» ausländischen, multinationalen Konzernen jegliche Gesetzes- und Verordnungsentwürfe, beispielsweise zu Umweltschutz oder Arbeitsrechten, bereits im Vorfeld zu kommentieren. Sollten die Konzerne mit den Entwürfen nicht einverstanden sein, könnten sie auf diese Weise Druck auf die nationalen Regierungen ausüben.
Das ist ein Einfallstor für weitere massive Deregulierungen zugunsten von Investitionen. Für China mag dies in Bezug auf seine Projekte entlang der Neuen Seidenstrasse äusserst vorteilhaft sein, aber es ist ganz bestimmt nicht im Interesse der Länder, die versuchen, sich einen gewissen Handlungsspielraum zu bewahren.
Südafrika, Indien und Indonesien wehrten sich bis zuletzt gegen eine Integration des Abkommens in die WTO, da sie dieses als illegal betrachten, und waren schliesslich erfolgreich. Die Befürworter des Abkommens beteuerten, dass diejenigen, die es nicht mitausgehandelt haben, von den Vorteilen profitieren würden, ohne dabei die Pflichten übernehmen zu müssen. Ein Argument, das die Gegenseite offensichtlich nicht überzeugen konnte. Die Frage bleibt nun, wie es mit dem Abkommen weitergeht, denn die Verhandlungen dazu sollen in Genf fortgeführt werden.
Ein weiterer wichtiger Schauplatz der Konferenz war die erneute Verlängerung des Moratoriums zu den Zöllen auf elektronische Übertragungen. Dabei geht es um das Verbot, Zölle zu erheben auf Filme, Musik und andere aus dem Internet herunterladbare Angebote und Dienstleistungen, sowie auf digitale Kommunikation.
Neben anderen Ländern wehrten sich abermals Indien, Südafrika und Indonesien entschieden gegen eine Verlängerung des Moratoriums. Sie sind der Ansicht, dass jedes Land selbst entscheiden sollte, ob es Zölle erheben möchte, um seine Industrie zu stärken und so seine digitale Souveränität sicherzustellen.
Die Vereinigten Staaten, die Schweiz, China und viele andere Staaten wollten das Moratorium unbedingt verlängern, doch diesmal war es ein harter Kampf. Um ihr Ziel zu erreichen, hätten die USA und die Schweiz womöglich bei einem anderen Moratorium nachgeben müssen, dessen Verlängerung sie ablehnen: Jenes zu Klagen bei Nichtverletzung des TRIPS-Abkommens, welches Indien und Südafrika im Gegenzug dringend verlängern wollen.
Diese unsägliche Bezeichnung steht für eine rechtliche Garantie für Länder, insbesondere Entwicklungsländer, dass sie nicht von einem anderen Mitgliedsstaat vor das WTO-Schiedsgericht gezerrt werden. Dies, wenn der Mitgliedsstaat der Meinung ist, seine Gewinne seien durch die Einführung anderer Massnahmen geschmälert worden, obwohl das TRIPS-Abkommen eingehalten wurde. Dabei ist es äusserst schwierig, ein konkretes Beispiel für einen solchen Fall zu nennen, da er aufgrund des geltenden Moratoriums nie eingetreten ist.
Auch sonst kamen keine substanziellen Ergebnisse zustande. Indien kämpfte bis zuletzt für eine dauerhafte Lösung in der Frage der Pflichtlagerhaltung in der Landwirtschaft. Diese würde es den Entwicklungsländern ermöglichen, ihre Bäuer:innen und Konsument:innen zu unterstützen, ohne eine Klage vor der WTO zu riskieren. Auf der Minister:innenkonferenz 2013 in Bali wurde eine Friedensklausel vereinbart, die so lange gelten sollte, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist. Diese ist jedoch nach wie vor nicht in Sicht.
Auch zu den Fischereisubventionen gab es keine Einigung; diesen Text lehnte auch die Zivilgesellschaft ab, da er ihrer Meinung nach die grossen Fischereibetriebe begünstigt hätte.
Besonders China verkörpert das neue Gesicht der internationalen Handelsbeziehungen. Nach dem WTO-Beitritt im Jahr 2005 hielt sich China, die grosse Gewinnerin der Globalisierung, noch bedeckt. Nun drängt das Land hingegen bei den wirtschaftsliberalsten Abkommen und beim Abwärtswettlauf im Sozial- und Umweltbereich.
Die Vereinigten Staaten hingegen sind weniger wirtschaftsliberal als üblich, insbesondere wenn es um Investitionen geht. Sie haben kürzlich industriepolitische Massnahmen ergriffen, welche als protektionistisch beurteilt werden. Dasselbe im elektronischen Handel: Die Biden-Regierung versuchte jüngst, Big Tech sachte zu regulieren. Hinsichtlich Fischerei verlangten die Vereinigten Staaten, dass ein Text zum Verbot von Zwangsarbeit auf Hochseeschiffen aufgenommen wird, was China entschieden und letztlich erfolgreich ablehnte.
In vielen Bereichen hat die Schweiz mit China jetzt eine überraschende Verbündete. Allerdings wird sie darauf achten müssen, entsprechend auch die Einhaltung von Menschenrechten sowie von Sozial- und Umweltstandards einzufordern.
Die Konferenz hat vor allem gezeigt, dass die neoliberale Globalisierung, deren Speerspitze die WTO seit 29 Jahren ist, in der Krise steckt. Es ist mehr denn je an der Zeit, gerechtere internationale Handelsbeziehungen aufzubauen.
Artikel teilen
Artikel
23.02.2024, Handel und Investitionen
Die dreizehnte Minister:innenkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) findet vom 26. – 29. Februar in Abu Dhabi statt. Investitionen, Klima, elektronische Übertragungen: Die Herausforderungen widerspiegeln einen immer gewichtigeren Nord-Süd-Graben – aber sie offenbaren auch Bruchstellen innerhalb des Globalen Südens.

Seit 2013 kein multilaterales Abkommen: An der WTO-Konferenz in Abu Dhabi drohen entwicklungspolitische Fortschritte im Sand zu verlaufen. Rub al-Chali Wüste auf emiratischem Gebiet.
© Shutterstock / Alexandre Caron
23 Jahre nach der Konferenz von Doha und der dortigen Lancierung der Entwicklungsagenda (sog. Doha-Runde) kehrt die Welthandelsorganisation (WTO) in die Golfstaaten zurück. Genauer gesagt nach Abu Dhabi, Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, wo während der letzten Februarwoche die dreizehnte Minister:innenkonferenz stattfinden wird.
Die Doha-Entwicklungsagenda wurde unmittelbar nach dem Schock der Terroranschläge vom 11. September verabschiedet, um die internationalen Handelsregeln zugunsten der Entwicklungsländer ausgewogener zu gestalten. Heute ist die Agenda bloss noch eine ferne Fata Morgana. Denn Fakt ist: Von den 100 ursprünglichen Vorschlägen sind lediglich zehn übriggeblieben, deren Substanz zudem immer mehr ausgehöhlt wurde.
Es gilt anzuerkennen, dass sich die Welt in zwei Jahrzehnten tiefgreifend verändert hat. Indien, Südafrika, China und andere grosse Länder, die noch immer von ihrem Status als «Entwicklungsland» profitieren, lassen sich ihren jeweiligen Willen nicht mehr von den «entwickelten Ländern» (so die offizielle Bezeichnung) diktieren. Letztere sind insbesondere die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und die Schweiz.
Infolgedessen gelangt die WTO – die mit dem in Abu Dhabi geplanten Beitritt Osttimors und der Komoren 166 Mitglieder zählen wird – bei keinem Thema zu einer Übereinkunft. In einer Organisation, in der Entscheide nach Konsensprinzip getroffen werden – sprich kein Mitglied darf sich dagegenstellen – ist es ein unmögliches Unterfangen geworden, sich zu verständigen. So kam es zu keinem multilateralen Abkommen seit der Revision des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen an der Minister:innenkonferenz von Bali im Jahr 2013. Ausserdem bilden die Entwicklungsländer längst keinen homogenen Block mehr.
Um dieses Hindernis zu umgehen, setzen bestimmte Länder, insbesondere die «entwickelten» Länder, in allerlei Bereichen vermehrt auf plurilaterale (also mehrere Länder umfassende) Initiativen. Das Investment Facilitation-Abkommen für Entwicklung, dessen Verhandlungen beim Minister:innentreffen von Buenos Aires im Jahr 2017 begannen, ist das am weitesten fortgeschrittene und könnte in Abu Dhabi verabschiedet werden. Lanciert von China mit der Unterstützung von 70 Ländern (darunter die Schweiz), umfasst es mittlerweile 110 Länder, darunter viele Entwicklungsländer.
Der traditionelle Graben zwischen Nord und Süd lässt sich hier aber nicht erkennen, ausser dass Indien und Südafrika die Initiative ablehnen. Dies taten sie bereits bei anderen plurilateralen Abkommen, weil sie befürchten, das multilaterale Prinzip werde weiter geschwächt.
Die Sorge der Zivilgesellschaft besteht darin, dass sich die Länder gezwungen sehen, ihre Türen für ausländische Investitionen zu öffnen, ohne sie kontrollieren oder einem entwicklungsdienlichen Rahmen unterstellen zu können. Das würde multinationalen Konzernen noch mehr Rechte einräumen. Zudem stellt sich die Frage, was mit einem Abkommen geschehen würde, das nicht von allen Mitgliedern ausgehandelt wurde.
Befürworter solch plurilateraler Ansätze argumentieren, dass bei Übernahme durch die WTO nur diejenigen Mitglieder, welche ein Abkommen ausgehandelt haben, an dessen Verpflichtungen gebunden wären. Die anderen würden lediglich von dessen Vorteilen profitieren.
Im Westen formiert sich bereits Widerstand gegen Indien, das sich traditionell als Fürsprecherin der Entwicklungsländer präsentiert. Gemeinsam mit seinem altbewährten Verbündeten Südafrika führt es den Aufstand gegen einseitige Umweltschutzmassnahmen an. Indien betrachtet diese als verschleierten Protektionismus und damit als Widerspruch zu den WTO-Prinzipien.
Besonders im Visier hat Indien den CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), eine von der EU eingeführte CO2-Grenzausgleichssteuer auf den Import von Produkten mit hohem Schadstoffausstoss, wie beispielsweise Aluminium aus Mosambik. Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD), die dieses Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiert, hat errechnet, dass die Auswirkungen auf das Klima minimal seien: Die Steuer würde die globalen CO2-Emissionen nur um 0,1 % senken. Das Einkommen der Industrieländer würde aber um 2,5 Mrd. US-Dollar steigen, während das Einkommen der Entwicklungsländer um 5,9 Mrd. US-Dollar reduziert würde.
Stattdessen empfiehlt die in Genf ansässige UNCTAD eine «positive Umweltagenda», die unter anderem den Transfer von grünen Technologien fördert.
Schliesslich bleibt in Abu Dhabi auch die offene Frage zu klären, ob das zweijährige Moratorium bezüglich der Steuern auf elektronische Übertragungen verlängert wird. Es geht darum, ein weiteres Mal darauf zu verzichten, dass das Herunterladen von Filmen, Musik und Büchern sowie die Kommunikation über elektronische Nachrichten-Apps besteuert wird. Alliance Sud nahm an allen bisherigen WTO-Minister:innenkonferenzen seit deren Entstehung teil. Sie konnte beobachten, wie sehr die Schweiz jeweils zusammen mit den USA auf der Verlängerung des Moratoriums beharrte – ohne dabei jemals wirklich zu verstehen, woraus das Schweizer Interesse bestand. Die Schätzungen über die entgangenen Gewinne für die Entwicklungsländer variieren, aber sie belaufen sich mindestens auf zig Milliarden US-Dollar.
Alliance Sud wird auch an dieser 13. Minister:innenkonferenz teilnehmen. Sie wird in Abu Dhabi sein, um gemeinsam mit anderen NGOs aus der ganzen Welt sicherzustellen, dass die Errungenschaften der Entwicklungszusammenarbeit nicht in den sandigen Weiten der emiratischen Wüste zerrinnen.
Artikel teilen
Medienmitteilung
17.12.2018, Handel und Investitionen
Die Palmöl-Problematik findet Eingang ins Freihandelsabkommen mit Indonesien. Hauptproblem bleibt die fehlende Verbindlichkeit.
Das heute in Jakarta unterzeichnete Freihandelsabkommen mit Indonesien anerkennt, dass Palmöl ein problematisches Produkt für Mensch und Umwelt in Indonesien wie auch für die Schweizer Bauern und Konsumentinnen ist. Nur so sind die Kontingente auf Palmöl, die begrenzten Zollerleichterungen und die Tatsache zu erklären, dass erstmals in einem Freihandelsabkommen ein einzelnes Produkt spezifisch angesprochen und mit Nachhaltigkeitsbedingungen versehen wird. Dies wertet die Palmölkoalition als Erfolg ihres permanenten Drucks auf die Verhandlungsparteien.
Indonesische und schweizerische Organisationen haben aufgezeigt, dass das importierte Palmöl bisher nicht nachhaltig produziert wird. Die existierenden Labels erfüllen die versprochenen Anforderungen nicht. Das grosse Problem des Abkommens bleibt zudem die fehlende Verbindlichkeit. Die Palmöl-Frage kann nur wirksam angegangen werden, wenn die Nachhaltigkeitskriterien überprüft und im Fall von Übertretungen Sanktionen ergriffen werden.
Wie der Bundesrat dies erreichen will, ist fraglich. Zudem liegt es nun am Bundesrat zu beweisen, dass sein Abkommen und seine Handelspolitik der Verfassung und seinen internationalen Verpflichtungen gerecht wird.
Medienkontakte:
Johanna Michel, Bruno Manser Fonds, +4179 868 45 15
Beat Röösli, Schweizer Bauernverband, +4179 768 05 45
Thomas Braunschweig, Public Eye, +4179 339 37 01

Artikel teilen
Medienmitteilung
18.12.2018, Handel und Investitionen
Im Freihandelsabkommen mit Indonesien drückt die Schweiz einen strengen Sortenschutz durch, der die Rechte der indonesischen Bäuerinnen und Bauern einschränkt und damit deren Ernährungssicherheit gefährdet.

Obwohl die Schweiz der UNO-Bauernrechtsdeklaration zugestimmt hat, die Hunger und Armut bekämpfen soll, drückt die Schweiz im Freihandelsabkommen mit Indonesien einen strengen Sortenschutz durch, der die Rechte der indonesischen Bäuerinnen und Bauern einschränkt und damit deren Ernährungssicherheit gefährdet. Ein Bündnis von sieben NGOs fordert deshalb von der Schweiz den Verzicht auf einen strengen Sortenschutz im Freihandelsabkommen.
Im Unterschied zur Schweiz produzieren die meisten Bauern und Bäuerinnen in Indonesien ihr Saatgut selber. Mit dem am Sonntag abgeschlossenen EFTA-Freihandelsabkommen verlangt die Schweiz von Indonesien, ein strenges Sortenschutzsystem einzuführen. Dieses soll sich nach dem Internationalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, UPOV 91, richten. UPOV 91 verbietet den Bauern nebst dem Verkauf auch den Tausch von geschützten Sorten. Zudem wird der Nachbau auf dem eigenen Hof auf ausgewählte Nutzpflanzen eingeschränkt und teilweise mit Nachbaugebühren belastet. Damit schränkt UPOV 91 den Zugang zu Saatgut für Bauern und Bäuerinnen stark ein, wovon vor allem die Saatgutindustrie profitiert. Ziehen sich die Bauern aus der Saatgutproduktion und -verteilung zurück, hat dies auch negative Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung. Diese Zerstörung des bäuerlichen Saatgutsystems führt zu einem Verlust der Sortenvielfalt. Das macht die landwirtschaftliche Produktion auch anfälliger auf den Klimawandel.
Heute verabschiedet die UNO eine Deklaration für die Rechte von Bauernfamilien und weiterer auf dem Land lebender Menschen. Die Deklaration ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Bekämpfung von Hunger und Armut. Gemeinsam mit der überwiegenden Mehrheit der Staaten hat die Schweiz für die Bauernrechtsdeklaration gestimmt. Es ist deshalb unverständlich, dass sie praktisch gleichzeitig einen strengen Sortenschutz von Indonesien verlangt. Denn UPOV 91 ist unvereinbar mit dem in der UNO-Deklaration festgeschriebenen Recht auf Saatgut.
Die Forderungen eines strengen Sortenschutzes nach UPOV 91 stehen nicht nur wegen der Bauernrechtsdeklaration quer in der Landschaft. Das EFTA-Land Norwegen ist nicht Mitglied von UPOV 91 und setzt dessen Standards auch nicht um. Damit wird von Indonesien verlangt, was selbst die Handelspartner nicht gewährleisten. Dabei bräuchte Indonesien dringend mehr Flexibilität beim Aufbau des Sortenschutzsystems, denn die Ernährungssicherheit im Land hängt vom freien Zugang zu Saatgut ab.
Alliance Sud, APBREBES, Brot für alle, Fastenopfer, Pro Specie Rara, Public Eye und SWISSAID fordern vom Bundesrat eine konsequente Umsetzung der Bauernrechtsdeklaration auch im Ausland – und damit einen Verzicht auf Forderungen nach einem strengeren Sortenschutz in Freihandelsabkommen.
Weitere Informationen:
Artikel teilen
Medienmitteilung
20.03.2019, Handel und Investitionen
Die Palmöl-Koalition fordert den Nationalrat auf, Palmöl aus dem Freihandelsabkommen mit Malaysia auszuschliessen. Ölpalmplantagen sind verantwortlich für die Zerstörung des Regenwaldes unweit des UNESCO-Weltnaturerbe in Sarawak/Malaysia.

Palmöl wird aus dem Fruchtfleisch der Früchte der Ölpalme gewonnen.
© Pixabay
Die Palmöl-Koalition*) fordert den Nationalrat auf, diesen Donnerstag seiner Linie treu zu bleiben und Palmöl aus dem geplanten Freihandelsabkommen mit Malaysia auszuschliessen. Ölpalmplantagen sind verantwortlich für die katastrophale Regenwaldzerstörung in unmittelbarer Nähe zum einzigen UNESCO-Weltnaturerbe in Sarawak, Malaysia.
Diesen Donnerstag wird der Nationalrat zwei Standesinitiativen behandeln, die den Ausschluss von Palmöl aus Freihandelsabkommen fordern. In der letzten Frühjahrssession hat sich der Nationalrat mit 140:35 Stimmen klar für den Ausschluss von Palmöl ausgesprochen. Die Palmöl-Koalition fordert den Nationalrat auf, seiner Linie treu zu bleiben und den entsprechenden Standesinitiativen aus den Kantonen Genf und Thurgau zuzustimmen.
Malaysia ist noch weit von einer nachhaltigen Palmöl-Produktion entfernt. Aktuell wird in unmittelbarer Nähe zum Mulu-Nationalpark, dem einzigen UNESCO-Weltnaturerbe des malaysischen Bundesstaates Sarawak, für eine Ölpalmplantage wertvoller Regenwald zerstört. Die Lokalbevölkerung der indigenen Gruppen der Penan und Berawan wurden nicht konsultiert. Die Palmölfirma verstösst damit gegen die international verbrieften Rechte der indigenen Bevölkerung. Das Vorgehen widerspricht auch dem wiederholten Versprechen Malaysias, die Abholzung für Ölpalmplantagen zu stoppen.
“Das ist leider nur einer von vielen Fällen, in welchem die Rechte der Lokalbevölkerung nicht respektiert werden und Regenwald für Palmöl zerstört wird”, so Johanna Michel, stellvertretende Geschäftsleiterin des Bruno Manser Fonds. Für Palmöl wird tagtäglich Regenwald zerstört. Dieses Palmöl gelangt auch in die Schweiz: 2018 importierte die Schweiz rund einen Viertel ihres Palmöls direkt aus Malaysia. Zollsenkungen im Rahmen des Freihandelsabkommens mit Malaysia würden den Palmölimport weiter ankurbeln und damit auch den einheimischen Rapsanbau und die Verarbeitung stark unter Druck setzen. Konsumentinnen und Konsumenten stehen Palmöl jedoch sehr kritisch gegenüber. Eine kürzlich vom Bruno Manser Fonds lancierte Petition, die ein Moratorium für weitere Ölpalmplantagen fordert, wurde bereits von mehr als 43’000 Personen unterzeichnet.
Medienkontakte
Johanna Michel, Bruno Manser Fonds, 079 868 45 15
Miges Baumann, Brot für alle, 079 489 38 24
Bertrand Sansonnens, Pro Natura/Friends of the Earth Switzerland, 076 396 02 22
*) Der Palmöl-Koalition gehören folgende Organisationen an: Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana, Alliance Sud, Biovision, Brot für alle, Bruno Manser Fonds, Fédération romande des consommateurs, PanEco, Pro Natura, Public Eye, Schweizer Bauernverband, Schweizerischer Getreideproduzentenverband, Stiftung für Konsumentenschutz, Uniterre.
Artikel teilen
Medienmitteilung
24.08.2019, Handel und Investitionen
Die NGO-Koalition zum Mercosur wird den Inhalt des Freihandelsabkommens mit dem Mercosur genau analysieren. Ohne verbindliche Kriterien für Nachhaltigkeit, Menschenrechts-, Tier- und Konsumentenschutz wird sie das Vertragswerk im Parlament bekämpfen.

Die Schweiz hat im Rahmen der EFTA ein Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten ausgehandelt. Die Mercosur-Koalition[1] wird den Inhalt des Abkommens genau analysieren. Wichtig ist, dass verbindliche Nachhaltigkeitskriterien und der Tierschutz aufgenommen wurden und mit dem Abkommen die sensiblen Landwirtschaftsprodukte nicht gefährdet, der Konsumentenschutz nicht geschwächt sowie die Menschenrechtssituation in den Mercosur-Ländern beachtet werden. Die Koalition wird im Parlament das Abkommen auf die Probe stellen und kritisch prüfen, ob diese unerlässlichen Kriterien erfüllt sind.
Seit Juni 2017 verhandelte die Schweiz im Rahmen der EFTA über ein Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten (Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay). Die Schweizer Exportwirtschaft erhofft sich dadurch einen besseren Zugang zu den Märkten in Südamerika. Das Abkommen hat jedoch auch Auswirkungen einerseits auf Bauernfamilien, die indigene Bevölkerung und die Umwelt in den Mercosur-Staaten, andererseits auch auf die Schweizer Landwirtschaft, die Arbeitsplätze im Ernährungssektor sowie auf die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten.
Auch Organisationen aus den Mercosur-Staaten teilen diese Befürchtungen. Die «Plateforme Amérique latine mieux sans accords de libre-échange» kritisiert, dass die Regierungen der Mercosur-Staaten mit der EFTA verhandelt haben, ohne sich mit den möglichen Auswirkungen dieses Abkommens zu befassen. Sie haben keine vorgängige Wirkungsanalyse durchgeführt. So wird befürchtet, dass das Abkommen mit der EFTA die geistigen Eigentumsrechte für Medikamente stärken wird, wie dies die grossen Schweizer Pharmaunternehmen fordern. «Infolgedessen werden die Kosten für die Medikamente steigen, obwohl unsere Länder von diesen Arzneimitteln abhängig sind», sagt Luciana Ghiotto, Koordinatorin der Plattform.
Bereits durch die Wahl Bolsonaros zum neuen Präsidenten hat sich die Situation der indigenen Bevölkerung Brasiliens stark verschlechtert. Die Sorge ist gross, dass das Freihandelsabkommen die Rechte der indigenen Bevölkerung weiter verletzt, da die steigende Nachfrage nach Agrargütern häufig das Land der Indigenen beansprucht. Deshalb hat sich jüngst die Gesellschaft für bedrohte Völker der Mercosur-Koalition angeschlossen.
Auch haben sich in den letzten Monaten die Meldungen über Abholzungen im Amazonas-Regenwald gehäuft. Zudem stehen zurzeit in Brasilien Wälder in Brand. Einer der bedeutendsten Kohlenstoffspeicher der Welt ist in Gefahr. Durch das Abkommen können diese Probleme noch verschärft werden.
Aufgrund der unterschiedlichen Bedenken verlangte die Mercosur-Koalition vom Bundesrat eine unabhängige ex-ante-Nachhaltigkeitsanalyse. Leider kam er dieser Forderung nicht nach. Das SECO hat eine Studie in Auftrag gegeben, die Resultate werden aber frühestens im Dezember erwartet, was definitiv zu spät ist.
Die Mercosur-Koalition hat ebenfalls mehrmals via Medien und direkt beim SECO gefordert, dass im Abkommen konkrete und verbindliche Nachhaltigkeitskriterien verankert werden sollen. Die Umsetzung der Agenda 2030, der Verfassungsartikel zur Ernährungssicherheit und nachhaltigem Handel (Art. 104a BV, Bst. d), das Pariser Klimaabkommen sowie Tierschutzaspekte müssen Teil des Abkommens sein.
Zudem forderte die Koalition, bei der Einfuhr von Landwirtschaftsprodukten die Zugeständnisse zwingend auf die bestehenden WTO-Kontingente zu beschränken. Auch muss aus den Mercosur-Staaten importiertes Fleisch ohne Leistungs- und Wachstumsförderer und unter Einhaltung hoher Tierschutz- und Lebensmittelsicherheitsstandards produziert worden sein. Damit der Konsumentenschutz nicht untergraben wird, sind die Kontrollen und die Deklaration importierter Lebensmittel zu verbessern und die Lücken zu beheben.
Die Mercosur-Koalition stellt sich nicht per se gegen das Freihandelsabkommen. Doch falls die genannten Kriterien nicht erfüllt sind, wird die Koalition das Abkommen im Parlament auf die Probe stellen.
Auskünfte bei:
[1] Die Mitglieder der Mercosur-Koalition: SWISSAID, Alliance Sud, Schweizer Bauernverband SBV, Schweizer Tierschutz STS, Fédération romande des consommateurs FRC, ACSI - Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana, Gesellschaft für bedrohte Völker GfbV, Public Eye, Brot für alle und Uniterre.

Artikel teilen
Medienmitteilung
04.12.2019, Handel und Investitionen
Solange die Zwangslager in Ostturkestan (Xinjiang) nicht geschlossen werden, soll das Freihandelsabkommen mit China sistiert werden. Das verlangen die GfbV, Alliance Sud und Public Eye.

Strassenszene aus Hotan in der chinesischen Provinz Xinjiang.
Die China Cables haben die Existenz von Zwangslagern bewiesen, worin 1-3 Millionen Uiguren gegen ihren Willen festgehalten und teilweise zur Zwangsarbeit gezwungen werden. Letzte Woche hatte Dolkun Isa, der Präsident des World Uighur Congress, in Bern die Schweizer Regierung und Behörden aufgefordert, ihre engen wirtschaftlichen Handelsbeziehung mit China zu überdenken, angefangen beim Freihandelsabkommen, das die Schweiz im Jahr 2013 unterzeichnet hat.
Angesichts der gravierenden Menschenrechtskrise in Ostturkestan (Xinjiang) fordern die Gesellschaft für bedrohte Völker, Alliance Sud und Public Eye die Schweizer Regierung und Behörden auf:
Diese Massnahmen sind aus Sicht der drei Organisationen zwingend, um zu vermeiden, dass die Schweiz und Schweizer Unternehmen zu indirekten Komplizinnen von schweren Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang werden. Das "International Consortium of Investigative Journalists" (ICIJ), welches die China Cables veröffentlicht hat, spricht von der schlimmsten Masseninhaftierung einer ethnisch-religiöse Minderheit seit dem Zweiten Weltkrieg.
Informationen und Auskunft:
Angela Mattli, Kampagnenleiterin Gesellschaft für bedrohte Völker, 079 378 54 30
Isolda Agazzi, Bereich Handel und Investitionen, Alliance Sud, 079 434 45 60
Thomas Braunschweig, Verantwortlicher Handelspolitik, Public Eye, 044 277 79 11
Artikel teilen
Medienmitteilung
24.01.2020, Handel und Investitionen
Die Schweiz muss vor der Ratifizierung des Freihandelsabkommens mit dem Mercosur die Auswirkungen des Abkommens auf die Menschenrechte überprüfen. Alliance Sud zeigt, wie das methodisch gemacht werden kann.

Ende August 2019 gab die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), der die Schweiz angehört, den Abschluss der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit dem Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay) bekannt. Der Text ist noch nicht publiziert.
Trotz der Empfehlungen der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK-N) weigert sich der Bundesrat, die Auswirkung des Freihandelsabkommens auf die nachhaltige Entwicklung und insbesondere die Menschenrechte zu prüfen, da es dafür keine adäquate Methodik gebe. Die GPK-N hat deshalb im vergangenen Jahr den Bundesrat in einem Postulat aufgefordert, eine Methodik zu entwickeln, was dieser akzeptiert hat.
In der Zwischenzeit liess Alliance Sud von der Juristin Caroline Dommen eine Ex-ante-Protostudie über die Auswirkungen des Mercosur-Freihandelsabkommens auf die Menschenrechte durchführen. Dies um zu zeigen, wie eine solche Methodik aussehen könnte. Da der Inhalt des Mercosur-Abkommens noch nicht bekannt ist, stützte sich die Expertin auf das Standard-Abkommen der Schweiz und ihre üblichen Forderungen – auf die je nach Machtverhältnissen mehr oder weniger eingegangen wird. Die Studie gibt zahlreiche Beispiele und schlägt Methoden und Indikatoren vor.
Ziel der Studie war es nicht, alle Menschenrechte zu analysieren, die von dem Abkommen betroffen sein könnten, sondern auf diejenigen zu fokussieren, welche die zivilgesellschaftlichen Partner von Alliance Sud vor Ort als die wichtigsten betrachten. Es sind dies:
Bestimmungen über geistiges Eigentum, die das Recht auf Gesundheit betreffen. Die von der Schweiz üblicherweise geforderte Stärkung der geistigen Eigentumsrechte führt zu Preiserhöhungen für Generika und verzögert deren Vermarktung. Die Mercosur-Länder lehnten dies heftig ab, weil es das Recht auf Gesundheit bedroht – in Argentinien sind 70% der auf dem Markt befindlichen Medikamente Generika. Bis jetzt hat die Schweiz in Freihandelsverträgen immer unnachgiebig auf diese Bestimmungen gepocht.
Bestimmungen über den Agrarhandel, die die Rechte der indigenen Völker beeinträchtigen. Die Expansion der Agrarindustrie führt zu Rodungen von Flächen und Wäldern, was oft zu Lasten indigener Völker geschieht, die dabei nicht einmal konsultiert werden.
Die Rechte der Frauen. Die Auswirkungen der Handelsliberalisierung auf die Rechte der Frauen variieren je nach Sektoren und Ländern. Es besteht jedoch die Gefahr, dass der Druck auf die am wenigsten wettbewerbsfähigen Sektoren, die meist Frauen beschäftigen, zunimmt. Niedrigere Zolleinnahmen können zum Nachteil der Frauen zu Kürzungen der Sozialausgaben führen.
Aufgrund der Studie empfiehlt Alliance Sud, dass die Schweiz vor dem Abschluss eines Freihandelsabkommens eine solche Folgenabschätzung durchführt und diese nach dem Inkrafttreten des Abkommens wiederholt. Alliance Sud fordert das Parlament auf, eine solche Studie zu verlangen, bevor es sich für oder gegen die Ratifizierung des Freihandelsabkommens mit dem Mercosur entscheidet. Andernfalls verfügt es nicht über eine ausreichende Informationsbasis, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Für weitere Informationen:
Isolda Agazzi, Leiterin des Bereichs Handel und Investitionen, Alliance Sud, +41 79 434 45 60
Artikel teilen