Artikel teilen
Die Südperspektive
Eine geschwächte Demokratie im Sog des Populismus
22.03.2024, Internationale Zusammenarbeit
Bolivien leidet unter einer schweren politischen Krise und einer wirtschaftlich düsteren Lage. Und trotzdem bietet die zunehmende Urbanisierung auch Chancen bei der nachhaltigen Armutsbekämpfung, schreibt Martín del Castillo.

Markt in Coroico, Yungas, wo viele Jugendliche Kokablätter verkaufen. © Meridith Kohut / The New York Times
In ganz Lateinamerika schwanken die Bukeles und Mileis, die Ortegas und Morales mit radikalen Diskursen und populistischen Forderungen zwischen der einen und der anderen Seite. Das Pendel schwingt aber nicht mehr zwischen den ideologischen Extremen, zwischen Verstaatlichung privater Unternehmen und radikalem Liberalismus. Es scheint, dass das Hin und Her jetzt den geopolitischen Interessen einiger strategischer Verbündeter dient: Vereinigte Staaten, China, Russland, Europäische Union. Sie unterstützen die besonderen Interessen und die Machtkonzentration der «messianischen Führer», indem sie deren politische Diskurse für ihre Zwecke instrumentalisieren.
Diese Dynamik der letzten zwei Jahrzehnte hat mehrere gemeinsame Nenner: schwache Staaten, Präsidialsysteme, Machtkonzentration in den Händen weniger Personen, kooptierte und korrupte Justizsysteme, geringe Legitimität des Parteiensystems und der nationalen Parlamente sowie wirtschaftliche Abhängigkeit vom Ausland. Bolivien ist kein Ausreisser und feiert demnächst 20 Jahre Populismus (davon 17 Jahre von der Linken und zwei von der Rechten dominiert), mit all den genannten und einigen anderen landesspezifischen Merkmalen.
Wie in den meisten Ländern der Region fehlt es den politischen Parteien an Legitimität. Die politische Elite sucht sich andere Kanäle, wie Kirchen oder zivilgesellschaftliche Organisationen oder Gewerkschaften, die die Kokabauern und -bäuerinnen vertreten (die wichtigste soziale Bewegung in Bolivien, aus der Evo Morales' politische Basis stammt). Letztere werden auf der Grundlage klientelistischer Interessen mobilisiert. Die Bolivianer:innen organisieren sich, beschweren sich, protestieren, aber machen keine konstruktiven Vorschläge.
Ebenso verfügt Bolivien über ein schwaches, weitgehend korruptes und illegitimes Justizsystem. Andere staatliche Einrichtungen haben begrenzte Kapazitäten, eine hohe Personalfluktuation, extreme Bürokratie und weisen fragwürdige Verwaltungsergebnisse auf. Ende des letzten Jahrtausends lagen 25% der Mittel für öffentliche Investitionen in den Händen der nationalen Regierung und 75% bei den lokalen Regierungen; letztere haben sich bis heute auf 20% reduziert. Die Zentralisierung der öffentlichen Entscheidungen und Haushalte bringt die institutionelle Schwäche Boliviens klar zum Ausdruck.
Seit der Präsidentschaft von Evo Morales (2005 bis 2019) hat Bolivien die Armutsquote deutlich gesenkt: die extreme Armut von 38% auf weniger als 15%, die moderate Armut von 60% auf 39%. Das makroökonomische Niveau blieb einigermassen stabil: Die Inflation liegt unter dem zweistelligen Bereich, das Wirtschaftswachstum beträgt durchschnittlich fast 4%.
Der lange Atem der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit
Während der Pandemie waren Beatmungsgeräte eine Mangelware, gerade ärmere Länder hatten keinen Zugang zu den überlebenswichtigen Maschinen. In Bolivien musste etwa medizinisches Personal per Hand Beatmungen durchführen. Aus der Not entwickelte eine bolivianische Universität ein kostengünstiges und schnell baubares automatisches Beatmungsgerät, das zum Selbstkostenpreis an abgelegene Gemeinden und ins Ausland verkauft wurde. Dies war nur dank der Unterstützung durch die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit möglich, die die Arbeit finanziert und Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren aufgebaut hat. Anlässlich der Schliessung des DEZA-Büros in Bolivien und des laufenden Ausstiegs der bilateralen Zusammenarbeit aus Lateinamerika und der Karibik im Jahr 2024 wird der freie Journalist Malte Seiwerth für Alliance Sud eine Reportage schreiben, die Sie ab April auf der Website lesen können.
Bolivien, die stabilste Wirtschaft in der Region?
Trotz solch vielversprechender Zahlen ist die derzeitige Wirtschaftslage in Bolivien nicht ermutigend: Der Anteil der informell erwerbstätigen Bevölkerung liegt bei fast 80%. Diese Menschen haben keinen Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen, erhalten keine Arbeitnehmer:innen-Leistungen und werden nicht besteuert. Hinzu kommt, dass die nachgewiesenen Gasreserven – die wichtigste Einnahme- und Exportquelle des Landes – drastisch zurückgegangen sind, der öffentliche Sektor erheblich gewachsen ist und die Subventionen für Treibstoffe für den Staatshaushalt nicht mehr tragbar sind.
Dies führte ab 2014 zu jahrelangen Haushaltsdefiziten und einer Abnahme der Devisenreserven. Die öffentliche Verschuldung, sowohl die externe als auch die interne, stieg exponentiell an. Heute leiden die Bolivianer:innen, insbesondere diejenigen, die im Importgeschäft tätig sind, unter einem drastischen Devisenmangel, der zu einem Schwarzmarkt und hohem Abwertungs- und Inflationsdruck geführt hat.
Ein weiteres Element ist das beschleunigte Wachstum der Städte. Ein beträchtlicher Teil der städtischen Bevölkerung lebt unter prekären Bedingungen in den Metropolen und Städten oder migriert zur Pflanz- und Erntezeit in die landwirtschaftlichen Gebiete. Das verursacht eine Ausweitung der landwirtschaftlichen Grenzen des Landes und setzt die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen in städtischen und stadtnahen Gebieten unter Druck.
In diesem Kontext verfolgt die nationale Regierung eine zweideutige Umweltpolitik. Unter dem Vorwand, die Besiedlung grosser unbewohnter Gebiete zu fördern, erleichtert sie die Migration im Tiefland. Dabei fördert sie die Ausdehnung der landwirtschaftlichen Grenzen und die Zunahme der Produktion von Kokablättern – meist für den illegalen Gebrauch. Gleichzeitig greift die Regierung auf Brandrodungen zurück, um mehr Land für den Anbau zur Verfügung zu stellen, wodurch Fauna und Flora geschädigt werden. Abholzung und Waldbrände sind eine Konstante im Amazonas und im Chiquitano-Trockenwald. Zudem sind die nationalen Verpflichtungen beim Klimaschutz noch lange nicht erfüllt.
Politische Krise als Chance
Derweil leidet die Regierungspartei (MAS - Movimiento al Socialismo) unter einem Zersetzungsprozess. Dem derzeitigen Präsidenten Luis Arce – dem ehemaligen Wirtschaftsminister von Evo Morales – ist es gelungen, einen grossen Teil der parteinahen Organisationen auf seine Seite zu ziehen. Evo Morales wiederum kontrolliert die wichtigsten regierungsfreundlichen Persönlichkeiten im Parlament und ist der derzeitige Vorsitzende der Partei sowie der wichtigste Anführer der Kokabäuerinnen und -bauern. Dieser Machtkampf hat zu Spaltungen in allen staatlichen Einrichtungen geführt und die öffentliche Verwaltung verlangsamt. Diese Entwicklung wird wohl bis zu den Wahlen im Jahr 2025 anhalten.
In diesem schwierigen Umfeld sind Chancen ein rares Gut, aber sie sind vorhanden und sollten genutzt werden. Die städtische Konzentration ist ein Motor für Innovation und Unternehmertum. Die Rolle des Privatsektors und der Wissenschaft kann für integrative sowie partizipative Entwicklungslösungen verstärkt werden. Die günstige Altersstruktur mit ihren vielen potenziellen Arbeitskräften ist beträchtlich und konzentriert sich auf mittelgrosse Städte und schnell wachsende Ballungsräume. Die ökologische Vielfalt, grosse Wälder und Gebirge bieten interessante Möglichkeiten.
Um die Chancen zu nutzen, sind Anstrengungen in der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, integrativer wirtschaftlicher Entwicklung, nachhaltiger Stadtentwicklung oder Abwasser- und Abfallwirtschaft nötig. Die internationale Zusammenarbeit muss diese Themen unterstützen und technische Begleitung leisten. Und schliesslich sind die Bürger:innen dafür verantwortlich, die Umsetzung der Entscheide und Massnahmen einzufordern. Dies kann dazu beitragen, dass die Bevölkerung, die aus der Armut herausgekommen ist, nicht wieder in Armut zurückfällt.

Martín del Castillo ist Wirtschaftswissenschaftler und Politologe mit Masterabschlüssen der Universitäten in Sucre, Bolivien, und Genf. Seit 2007 arbeitet er für Helvetas.
Global, Meinung
Mythos Schuldenbremse: Rumpelstilzchen regiert
02.04.2024, Internationale Zusammenarbeit, Finanzen und Steuern
Ist Sparen wirklich das Gebot der Stunde? Ein umfassendes Umdenken ist dringend nötig, denn die Schuldenquote ist die beste Freundin der internationalen Zusammenarbeit. Dank ihr kann es sich die Schweiz mehr als leisten, die Kosten für die Ukrainehilfe ausserordentlich zu verbuchen und so die Entwicklungszusammenarbeit in den Ländern des Globalen Südens zu retten.

Andreas Missbach, Geschäftsleiter von Alliance Sud. © Daniel Rihs
Im Geschichtsstudium haben wir gelernt, dass der wissenschaftliche Fortschritt in den Fussnoten stattfindet. Erfreut habe ich kürzlich festgestellt, dass das auch für Bundesbern gilt. So weist die eidgenössische Finanzverwaltung in einer Fussnote zum Legislaturfinanzplan 23 – 27 auf die Diskrepanz zwischen dem internationalen Standard zur Nachhaltigkeit von Schulden und der Schweizer Praxis hin: Einerseits gibt es das Nachhaltigkeitskonzept, das «dem international von OECD, IWF und EU-Kommission anerkannten Standard (entspricht). Danach sind die öffentlichen Finanzen nachhaltig, wenn die Staatsschulden im Verhältnis zum BIP (Schuldenquote) auf einem ausreichend tiefen Niveau stabilisiert werden können. Die Schuldenbremse des Bundes ist restriktiver. Sie stabilisiert die Schulden des Bundes zu ihrem nominalen Wert in Franken.»
Auch in Franken waren die Schulden 2022 – trotz Corona – niedriger als 2002 bis 2008, als die Schweiz auch nicht gerade darnieder lag. Aber eben, entscheidend sind sowieso nicht die absoluten Schulden, sondern ihr Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt (man kann diesen Satz nicht oft genug sagen). Wie hoch ist denn diese Quote? Schauen wir nach in der jüngsten Ausgabe von «Grundlagen der Haushaltsführung des Bundes», einer Publikation der Finanzverwaltung, die sich an die Parlamentarier:innen richtet. 2022 betrug die Schuldenquote gemäss Maastricht-Definition der EU 26.2% und die Nettoschuldenquote, so wie sie der internationale Währungsfonds IWF berechnet, lag bei 15,3%. Gemäss Legislaturfinanzplan hingegen (der ein Monat nach den «Grundlagen» publiziert wurde) beträgt die Nettoschuldenquote aber 18,1%. Offensichtlich haben nicht nur das Verteidigungsdepartement und der Armeechef ein Problem mit den Zahlen (für 2023 liegt die Quote laut der Finanzministerin in der Frühlingssession bei 17,8%).
«Die Schuldenbremse ist meine beste Freundin», sagte Karin Keller-Sutter gegenüber der NZZ. Uns scheint allerdings eher, dass die Schuldenbremse Rumpelstilzchen ist: «Ach wie gut, dass niemand weiss …». Wobei – und auch diesen Satz kann man nicht oft genug wiederholen –, egal wie man die Schuldenquote der Schweiz misst, sie ist in jedem Fall im internationalen Vergleich lächerlich gering.
«Wiegt der Nutzen tiefer Schulden deren Kosten auf? Denn Schuldenabbau ist nicht gratis. Jeder Franken, der für Rückzahlung von Staatsschulden eingesetzt wird, ist ein Franken, der nicht für andere Staatsleistungen zur Verfügung steht», gibt Marius Brülhart, Volkswirtschaftsprofessor der Uni Lausanne, zu bedenken. Wo er das schreibt, ist ein Silberstreifen am Horizont, in der «Volkswirtschaft» nämlich, dem wirtschaftspolitischen Magazin des SECO. Bei Mitte-Präsident Gerhard Pfister, der sich für eine ausserordentliche Finanzierung der Ukraine-Kosten (Flüchtlinge und Wiederaufbau) ausspricht, ist das Thema angekommen. Ein umfassendes Umdenken ist dringend nötig, denn die Schuldenquote ist die beste Freundin der internationalen Zusammenarbeit. Dank ihr kann es sich die Schweiz mehr als leisten, die Kosten für die Ukrainehilfe ausserordentlich zu verbuchen und so die Entwicklungszusammenarbeit in den Ländern des Globalen Südens zu retten.
Wiegt der Nutzen tiefer Schulden deren Kosten auf? Denn Schuldenabbau ist nicht gratis. Jeder Franken, der für Rückzahlung von Staatsschulden eingesetzt wird, ist ein Franken, der nicht für andere Staatsleistungen zur Verfügung steht.
(Marius Brülhart)
Artikel teilen

global
Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.
Medienmitteilung
Mehr Mittel für die Ukraine: Die Mitte muss jetzt liefern
05.03.2024, Internationale Zusammenarbeit, Entwicklungsfinanzierung
Der Nationalrat hat heute den Vorstoss seiner Finanzkommission abgelehnt, der sichergestellt hätte, dass der Ukraine-Wiederaufbau nicht auf Kosten des Globalen Südens finanziert wird. Nun ist es an der Mitte, den Worten ihrer Stellungnahme zur internationalen Zusammenarbeit 2025-2028 auch Taten folgen zu lassen.

© Parlamentdienste, 3003 Bern / Monika Flückiger
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski trifft die Präsident:innen von Nationalrat und Ständerat bei seinem Besuch in der Schweiz im Januar 2024.
Gemäss Entwurf der Strategie für die internationale Zusammenarbeit (IZA) 2025-2028 will der Bundesrat in den nächsten vier Jahren mindestens 1,5 Milliarden Franken für die Ukraine verwenden. Die Vernehmlassung hat aber deutlich gezeigt, dass eine solidarische Unterstützung der Ukraine nicht auf Kosten anderer Schwerpunkte und Programme gehen darf. So fordert auch die Mitte in ihrer Vernehmlassungsantwort zur IZA-Strategie, «(d)ass die Mehrausgaben zugunsten der Ukraine separat ausgewiesen und beantragt werden», und «dass die Verpflichtungskredite der vorliegenden IZA-Strategie deswegen nicht gekürzt werden».
Ganz und gar unverständlich ist deshalb die heutige Ablehnung der Motion zur Schaffung eines Fonds für den Wiederaufbau der Ukraine (Mo. 23.4350). «Die Mitte hat es heute verpasst, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen: Sie muss nun bis zur Behandlung der Strategie in den Räten mehrheitsfähige Vorschläge für die Finanzierung des Ukraine-Wiederaufbaus ausserhalb der IZA ausarbeiten.», sagt Andreas Missbach, Geschäftsleiter von Alliance Sud, dem Schweizer Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik. Alles andere «(…) steht im Widerspruch zur humanitären Tradition der Schweiz und kann aus Sicht der Mitte nicht im langfristigen Interesse des Landes sein», wie sie selbst in ihrer Vernehmlassungsantwort schreibt.
Weitere Informationen:
Andreas Missbach, Geschäftsleiter Alliance Sud, Tel. 031 390 93 30, andreas.missbach@alliancesud.ch
Faktenblatt zum ausserordentlich finanzierten Wiederaufbau der Ukraine
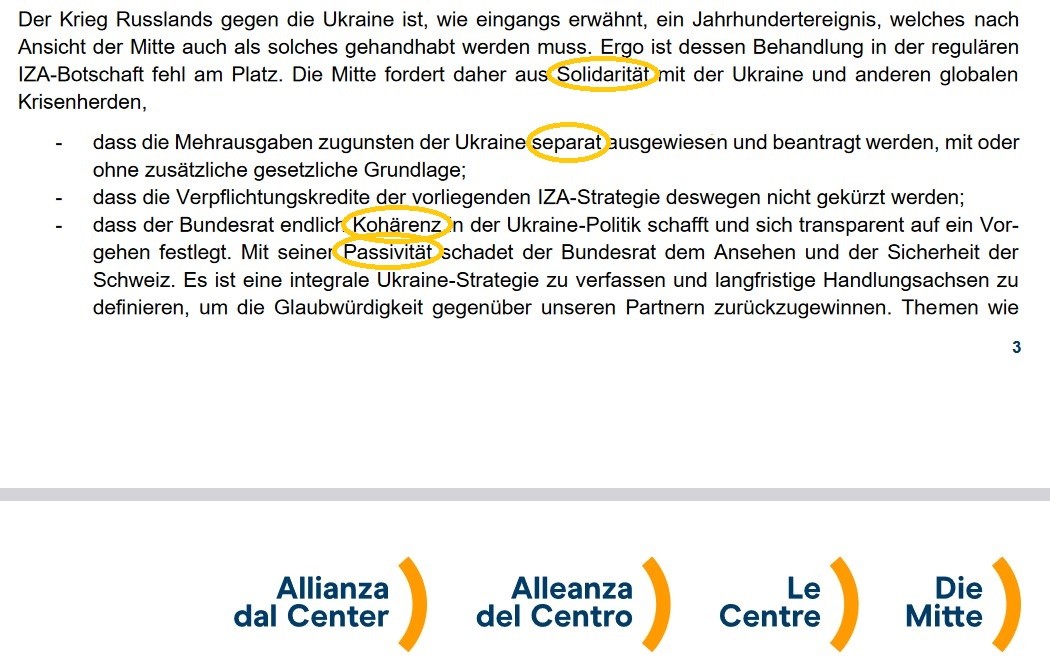
© Screenshot Alliance Sud, eigene Markierung
Die Mitte predigt in ihrer Vernehmlassungsantwort Solidarität und Kohärenz, setzt aber im Parlament auf Passivität wie der Bundesrat.
Artikel teilen
Artikel
«Frauen sind keine abstrakten Subjekte»
23.03.2020, Internationale Zusammenarbeit
Die zentrale Rolle der Frauen für eine nachhaltige Entwicklung ist unbestritten. Selbst die Weltbank verfolgt eine Gender-Strategie. Doch gibt es eine richtige Strategie in einer falschen? Antworten von Genderforscherin Elisabeth Prügl.

global: Die Weltbank vermarktet sich seit einigen Jahren als Champion für Geschlechtergerechtigkeit. Wie kommt das?
Elisabeth Prügl: Geschlechtergerechtigkeit ist heute in der Tat ein zentrales Thema für die Weltbank – dafür gibt es mehrere Gründe. 2007 beschloss die Führung der Bank ernsthaft, eine Gender-Strategie zu implementieren, und anerkannte damit, dass Geschlechterverhältnisse für wirtschaftliche Entwicklungsprozesse relevant sind. Bis dahin war Geschlecht in erster Linie als sozialpolitisches Thema in der Erziehungs- und Gesundheitspolitik verhandelt worden, nun sollte es ein Thema der Wirtschaftspolitik werden. Das Argument dafür war, dass Geschlechtergerechtigkeit eine Sache des klugen Wirtschaftens sei («Gender Equality as Smart Economics»), Geschlechtergerechtigkeit soll also wirtschaftliches Wachstum unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat die Weltbank einige Forschungsprojekte und Datenerhebungen im Bereich Gender und Entwicklung finanziert, ein internes Gender-Monitoring von Projekten und Programmen eingeführt sowie die Zusammenarbeit auch mit Partnern aus dem Privatsektor gesucht. Nachdem die UNO in der Agenda 2030 der Geschlechtergerechtigkeit eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung gewidmet hat, schrieb die Bank 2016 eine neue Gender-Strategie, die auf ihrer eigenen, umfassenden Forschung aufbauen konnte. Und diese kam unter anderem zum Schluss, dass Management und Belegschaft mittlerweile bedeutend mehr Zeit in Genderthemen investierten. So ist die Weltbank zum Gender-Champion mutiert.
Die Weltbank ist mitverantwortlich dafür, dass heute fast alle der Meinung sind, ohne Privatsektor gebe es keine Entwicklung. Durch ihre Beratungsdienstleistungen und Darlehen propagiert sie in Entwicklungsländern Reformen, die auf Handelsöffnung, finanzielle Deregulierung und die Privatisierung von Infrastruktur und öffentlichen Dienstleistungen abzielen. Diese Privatisierungsagenda wird von feministischen Gruppierungen stark kritisiert. Warum?
Die Weltbank ist ein integraler Bestandteil der neoliberal geprägten Weltwirtschaftsordnung: Ihre Forschungsarbeiten, Projekte und Programme vertrauen unkritisch auf den Markt und basieren auf der Überzeugung, dass das Gemeinwohl am besten durch Marktanreize realisiert werde. Die zentralen Akteure in dieser Ideologie sind Privatpersonen und Firmen; und auch die staatliche Verwaltung soll sich an der Marktlogik orientieren.
Nun hat aber die Erfahrung der letzten 40 Jahre gezeigt, dass das uneingeschränkte Vertrauen in den freien Markt und die Privatwirtschaft extreme Ungleichheit geschaffen hat. Zudem zeigt eine freie Marktwirtschaft wenig Interesse an der Bereitstellung von zentralen Dienstleistungen, wie zum Beispiel der Pflege, der Erziehung oder des Gesundheitswesens – alles Bereiche, in denen Frauen überproportional beschäftigt sind, sei es als bezahlte, vor allem aber auch als unbezahlte Arbeitskräfte. Doch keine Gesellschaft, keine Wirtschaft kommt ohne diese Bereiche aus. Sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern hat die einseitige Bevorzugung des freien Marktes Krisen in den für die soziale Reproduktion und Pflege wichtigen Bereichen ausgelöst; und die Kosten dieser Krisen werden oftmals auf Frauen als unter- oder unbezahlte Arbeitskräfte abgewälzt. Das erklärt, dass viele Feministinnen dem neoliberalen Vertrauen auf den Markt und auf Privatisierung sehr kritisch gegenüber stehen.
Gender-Champion auf der einen Seite, Promotorin von Projekten und Politiken, die Frauen besonders schaden, auf der anderen. Wie bewerten Sie das Engagement der Weltbank im Bereich Geschlechtergerechtigkeit?
Die Weltbank tendiert dazu, Frauen für die Entwicklung zu instrumentalisieren: Geschlechtergerechtigkeit wird in erster Linie als wichtiger Faktor für wirtschaftliches Wachstum und Armutsbekämpfung dargestellt. Frauen sind in den Empfehlungen der Weltbank abstrakte Subjekte, die in die existierende Wirtschaftsordnung integriert werden müssen. Aber die Bank ist kein Monolith; innerhalb der Organisation findet man diverse Vorstellungen, auch voneinander abweichende feministische Auffassungen. Einige dieser Ideen haben Eingang in die neue Gender-Strategie der Bank gefunden. So beinhaltet die Strategie neben herkömmlichen Vorschlägen, wie einem besseren Zugang für Frauen zur Arbeitswelt, auch eher unorthodoxe Anregungen wie zum Beispiel bessere Kinderversorgung und Pflege sowie Massnahmen gegen häusliche Gewalt. Wenn diese Ziele als zentral für die Beteiligung von Frauen in der Wirtschaft anerkannt werden, verändert sich auch das Verständnis von wirtschaftlicher Entwicklung. Und obwohl die Gender-Strategie der Bank orthodoxe, makro-ökonomische Modelle nach wie vor nicht prinzipiell hinterfragt, beginnt sie diese Modelle immerhin zu erweitern. Kurz, dem Ansatz der Weltbank stehe ich kritisch gegenüber, aber ihr Interesse an der Geschlechtergerechtigkeit bewerte ich positiv.
In welchen Punkten muss sich die Weltbank verbessern, um dem Ziel der Geschlechtergerechtigkeit näher zu kommen?
Zwei Interventionen sind meines Erachtens zentral: Erstens hat die Weltbank in den letzten Jahren wichtige Forschungsarbeiten geliefert, um die zentrale Rolle von Frauen und von geschlechtsspezifischen Praktiken in der wirtschaftlichen Entwicklung sichtbar zu machen. Diese Forschung hat grossen Einfluss. Feministische Wirtschaftstheorien kommen in diesen Arbeiten jedoch oft zu kurz. Die Weltbank muss feministischen Ansätzen mehr Aufmerksamkeit schenken. Die Zusammenarbeit mit UN Women bietet dazu ausgezeichnete Möglichkeiten.
Zweitens gibt es nach wie vor Schwachpunkte in der Implementierung ihres Geschlechteransatzes. Für die Genderarbeit stehen relativ wenig finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Diese Arbeit kann nicht an Firmen delegiert werden, die in der Regel über wenig Genderexpertise verfügen und meinen, mit einer Erhöhung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen sei es getan; auch braucht es mehr als bloss Unternehmertrainings für Frauen. Geschlechtergerechtigkeit funktioniert nur, wenn sie auf einem grundlegenden Verständnis basiert, wie sich das Geschlecht in Gesellschaft und Wirtschaft im Zusammenklang mit anderen sozialen Differenzen, insbesondere der sozialen Klasse, auswirkt.
Elisabeth Prügl - Genderforscherin am IHEID
Elisabeth Prügl leitet am Graduate Institute für Internationale und Entwicklungsstudien (IHEID) in Genf das Gender Centre. Schwerpunkt ihrer Lehre und Forschung in den USA und der Schweiz ist Gender-Politik in der internationalen Regierungsführung. 2019 erhielt sie den «Eminent Scholar Award» der International Studies Association (ISA) im Bereich feministische Theorie und Gender Studies.
Artikel teilen
Artikel
Weltbank: Ein problematisches Schweizer Engagement
11.05.2020, Internationale Zusammenarbeit, Entwicklungsfinanzierung
Trotz gegenteiliger Beteuerungen bleibt die Politik der Weltbank namentlich in Sachen Menschenrechte und Klima hochproblematisch. Macht die Schweiz bei den Kapitalerhöhungen mit, muss sie ihren Einfluss für eine Kursänderung geltend machen.

Die Weltbank-Kapitalerhöhungen aus entwicklungspolitischer Sicht: Die Position von Alliance Sud
Trotz gegenteiliger Beteuerungen bleibt die Politik der Weltbank namentlich in Sachen Menschenrechte und Klima hochproblematisch.
Die Schweiz muss ihren Einfluss für eine Kursänderung geltend machen.
Artikel teilen
Artikel
Wer sich engagiert, lebt gefährlich
22.06.2020, Internationale Zusammenarbeit
Das neoliberal geprägte Entwicklungsmodell hat jahrzehntelang die Unterdrückung der Menschenrechte in Kauf genommen. Zeit für einen Paradigmenwechsel.

Allein 2019 wurden laut dem Business and Human Rights Center im Kontext von Firmenaktivitäten 572 Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger und Umweltaktivistinnen verzeichnet, rund ein Drittel davon betraf Frauen. Die Übergriffe reichten von fristloser Kündigung – wie etwa in Bangladesch, als 12 000 Textilarbeiterinnen nach Protesten entlassen wurden – bis hin zu Einschüchterung, polizeilicher Gewalt und Mord. In den allermeisten Fällen hat diese Repression für die Täter keine Folgen, da Regierung und Firmen im Namen der «Entwicklung» zusammenspannen. Menschen, die sich gegen Landraub, die Vergiftung von Flüssen oder die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen wehren, werden von Regierungen und den betroffenen Firmen oft pauschal als «Feinde der Entwicklung» bezeichnet.
Häufig sind Entwicklungsbanken in die Finanzierung solcher Aktivitäten verwickelt. Ein 2019 publizierter Bericht der Coalition for Human Rights in Development analysiert die Rolle von Entwicklungsbanken in 25 Infrastruktur- und Entwicklungsprojekten, die mit massiver Repression einhergingen. Elf der analysierten Projekte beinhalteten Finanzierung durch die International Finance Corporation (IFC), sechs wurden von anderen Weltbankunterorganisationen finanziert. Die Fallstudien beinhalten u.a. die polizeiliche Niederschlagung eines Streiks in Südafrika gegen ein von der IFC finanziertes Bergbauunternehmen im Jahr 2012, bekannt als Massaker von Marikana, bei dem 34 Menschen getötet wurden und das als die blutigste Gewaltanwendung einer südafrikanischen Regierung seit 1960 gilt; die Ermordung von Gloria Capitan im Jahr 2016, die sich gegen die intensive Luftverschmutzung wehrte, welche durch die IFC finanzierte Kohleprojekte auf den Philippinen verursacht wurde, und die Inhaftierung von Pastor Omot Agwa, der die indigenen Anuak in Äthiopien bei ihrer Beschwerde wegen Vertreibung gegen die Weltbank unterstützt hatte. Der Bericht kommt zum Schluss, dass die Entwicklungsbanken meist nichts gegen die Repression unternehmen, die mit von ihnen finanzierten Projekten einhergeht. Reaktionen kommen zu spät und gehen zu wenig weit, betroffene AktivistInnen erhalten selten Schadensersatz und bleiben weiterer Repression schutzlos ausgeliefert. Oft werden Regierungen und Firmen, die in Menschenrechtsverletzungen involviert sind, von den Entwicklungsbanken weiter finanziert, selbst nachdem Unterdrückungs- und Vergeltungsmassnahmen publik geworden sind.
In den letzten Jahren wurden die Rechte der Zivilgesellschaft in vielen Ländern weiter eingeschränkt, so dass es für AktivistInnen immer schwieriger und gefährlicher wird, sich gegen die Politik ihrer Regierung oder gegen vermeintliche Entwicklungsprojekte zu wehren. Die Massnahmen zur Bekämpfung der aktuellen Corona-Pandemie verschärfen diesen Trend in vielen Ländern noch zusätzlich. Umso wichtiger ist es darum, dass Firmen, Investoren und Entwicklungsbanken diesem Trend entgegenwirken und bei ihren Projekten die betroffene Bevölkerung von Anfang an mit einbeziehen und sich klar für den Schutz der Menschenrechte einsetzen. Immerhin: Im März 2020 hat sich eine Gruppe von 176 internationalen Investoren mit einem verwalteten Vermögen von über 4,5 Billionen US-Dollar in einem offenen Brief an die 95 Unternehmen mit den schlechtesten Ergebnissen bei der Sorgfaltspflicht im Bereich Menschenrechte gewandt und sie dazu angehalten, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Die Weltbank hat parallel dazu ein Statement gegen Vergeltungsmassnahmen veröffentlicht.
Schöne Worte allein genügen aber nicht. Der Begriff der Entwicklung muss kritisch diskutiert, alternative Entwicklungsmodelle, die vom neoliberalen, ressourcenintensiven Wachstumsmodell abweichen, müssen zugelassen werden. Als Ausgangspunkt kann die UN-Agenda 2030 dienen. Sie bietet eine holistische Vision von Entwicklung, nach der alle – die reichen und die ärmeren Länder – angehalten sind, Ungleichheit zu reduzieren und ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu fördern; und gemäss dem Prinzip Leave no-one behind sollen die Bedürfnisse der Ärmsten und marginalisiertesten Bevölkerungsschichten im Zentrum von Entwicklung stehen.
Eine kurze Geschichte der «Entwicklung»
kl. 1949 sprach der US-amerikanische Präsident Harry S. Truman das erste Mal in einer Ansprache an die Nation davon, dass die reichen «entwickelten» Nationen ihren Fortschritt nutzen müssten, um den ärmeren «unterentwickelten» Ländern bei ihrer Entwicklung beizustehen. Es ist die Geburtsstunde eines linearen, entpolitisierten und durch und durch kapitalistischen Bilds von Entwicklung. Demgemäss ist der Westen dank harter Arbeit, Fleiss und Innovation den armen Ländern auf dem Pfad der Entwicklung ein paar Schritte voraus. Sklaverei, Imperialismus und Kolonialismus, die diesen «Entwicklungsfortschritt» bedingten, bleiben ausgeblendet. Nun sei es an den ärmeren Ländern, die richtigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und sich mit der grosszügigen Hilfe der reicheren Nationen deren Lebensstandard anzunähern. Die vom Westen propagierten entwicklungspolitischen Rahmenbedingungen waren allerdings von Anfang an darauf angelegt, westlichen Firmen und Regierungen den Zugang zu den unentbehrlichen Rohstoffen und Ressourcen der ärmeren Länder offenzuhalten; auch war die sogenannte «Entwicklungshilfe» meist an Bedingungen geknüpft, die den westlichen Firmen einen Absatzmarkt in den ärmeren Ländern garantierten, für diese gebundene Hilfe hat sich der Begriff tied aid durchgesetzt.
Heutzutage konkurrieren verschiedene Konzepte von Entwicklung miteinander und die Entwicklungshilfe hat sich massiv verändert. Sie hat sich grösstenteils vom tied aid-Prinzip abgewandt und setzt vermehrt auf Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung, daher die Bezeichnung Entwicklungszusammenarbeit (kurz EZA), die sich im breiten Sprachgebrauch allerdings nie auf ganzer Linie durchzusetzen vermochte.
Das dominierende Modell von Entwicklung, das von den meisten Regierungen und einflussreichen internationalen Institutionen – allen voran der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds – propagiert wird, basiert jedoch nach wie vor auf dem Anlocken von ausländischen Direktinvestitionen und Handelsliberalisierung, die zum obersten Ziel – dem Wirtschaftswachstum – führen sollen. Den Entwicklungsländern wird dabei «geholfen», Investoren anzulocken, die sich in gross dimensionierten Infrastruktur-, Landwirtschafts- und Energieprojekten engagieren, die häufig primär der Exportförderung dienen. Die Regierungen ihrerseits verpflichten sich, protektionistische Handelsregulierungen abzubauen, die Privatisierung voranzutreiben und den Investoren Land und Ressourcen zu guten Konditionen zur Verfügung zu stellen. Oftmals sind es dann auch regierungsnahe Kreise, die durch die weitverbreitete Korruption am meisten von der Präsenz ausländischer Investoren profitieren und gerne ein Auge zudrücken, wenn es um den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt geht.
Artikel teilen
Artikel
Fünf Fragen in den Süden zur Coronakrise
22.06.2020, Internationale Zusammenarbeit
Was bedeutet die Coronakrise für die Menschen im globalen Süden? «global» hat fünf Menschen aus fünf Ländern befragt. Ein Schlaglicht ohne Anspruch auf Repräsentativität.
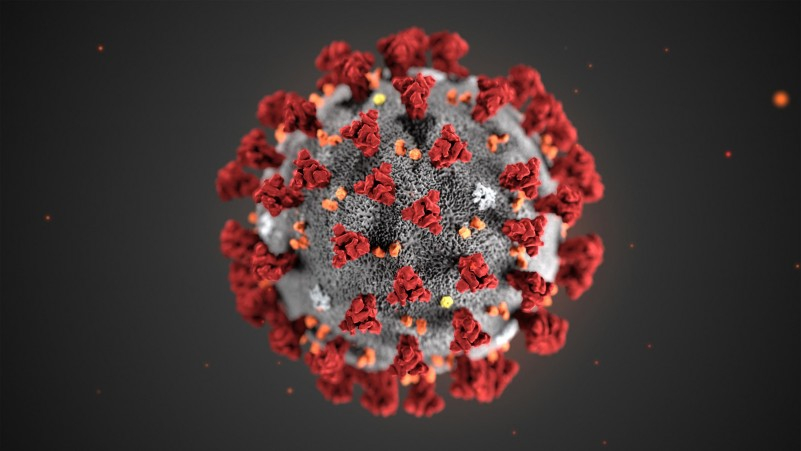
Ravikant Tupkar, Leiter der Bauernorganisation Swabhimani in Maharashtra, Indien

Ravikant Tupkar
- Wie erleben Sie persönlich die Coronakrise?
Die Regierung beschuldigt die Muslime und vernachlässigt ihren Auftrag, die Grundbedürfnisse aller zu decken. Umso grösseren Respekt habe ich vor jenen, die auch ohne ausreichende Schutzausrüstung gegen die Verbreitung des Virus kämpfen. - Welche Ihrer Freiheiten wurden eingeschränkt?
Die Regierung hat die Bewegungsfreiheit radikal eingeschränkt und setzt das strikt durch. Ernte auf dem Markt zu verkaufen, bleibt erlaubt. Wer sich nicht ans social distancing hält, kann bestraft werden, dasselbe gilt für Meinungsäusserungen im Internet. - Wie wirkt sich die Krise in Ihrem Land auf die verletzlichsten Menschen aus?
Kleine Betriebe verlieren die Existenzgrundlage, immer mehr Menschen landen auf der Strasse. Auch Leute mit einer Ausbildung verlieren ihre Arbeit, wahrscheinlich wird die Zahl der Bauern, die sich aus Verzweiflung das Leben nehmen, ansteige - Was werden die Folgen der Coronakrise sein?
Die religiösen Spannungen drohen zu eskalieren, Mobbing und Ausschreitungen zuzunehmen. Die Abriegelung war für die Wirtschaft verheerend. Sollten jetzt auch noch ausländische Unternehmen ihre Investitionen abziehen, wäre das katastrophal. - Gibt es auch Anlass zur Hoffnung?
Ich bete, dass mein Land und auch der Rest der Welt diese Krankheit schnell und sicher überwinden mögen.
Angela Ospina Rincón, Direktorin des Zentrums für psychosoziale Betreuung in Bogotà, Kolumbien

Angela Ospina
- Wie erleben Sie persönlich die Coronakrise?
Ich bin sehr besorgt über die zunehmende Verletzung der Menschenrechte und haben unsere Arbeit neu ausgerichtet. Im Zentrum stehen Denunziation und die Auswirkungen der Ausgangssperre für die über 70jährigen auf deren elementare Menschenrechte. - Welche Ihrer Freiheiten wurden eingeschränkt?
Abgesehen von den Alten setzt Kolumbien auf Herdenimmunität, das verstärkt das bestehende Gefühl der Unsicherheit. Die Opposition war schon vorher stark eingeschränkt. Die Regierung nutzt die Pandemie, um ihre Agenda voranzubringen. - Wie wirkt sich die Krise in Ihrem Land auf die verletzlichsten Menschen aus?
Die Pandemie wirft ein Schlaglicht auf die extreme Ungleichheit in Kolumbien, die hier am zweitstärksten ausgeprägt ist in Lateinamerika. Die Ärmsten leiden Hunger, ihre Proteste werden mit Tränengas, Schlägen und Verhaftungen unterdrückt. - Was werden die Folgen der Coronakrise sein?
Armut, Hunger und Arbeitslosigkeit werden zunehmen. Es wird zu sozialen Unruhen kommen. Wenn das Virus uns nicht tötet, ist es der Hunger. Präsident Duque regiert zu Gunsten seiner Anhänger gegen das Volk, öffentliche Mittel werden zweckentfremdet. - Gibt es auch Anlass zur Hoffnung?
Ja, inmitten grosser Repression gibt es aus der Mitte der Bevölkerung eine grosse Welle der Solidarität. Soziale und Menschenrechtsorganisationen haben ihre Arbeit unter schwierigsten Bedingungen aufrechterhalten.
Djalma Costa, Direktionsmitglied des Kinderrechtszentrums CEDECA in Sao Paulo, Brasilien

Djalma Costa
- Wie erleben Sie persönlich die Coronakrise?
Die Dimension, welche die Gesundheitskrise in Brasilien annimmt, bereitet mir allergrösste Sorgen. Dies vor allem auch, weil wir keine verlässliche politische Führung haben, die den BrasilianerInnen mehr Sicherheit vermittelt. - Welche Ihrer Freiheiten wurden eingeschränkt?
Die verordnete Quarantäne hat eine direkte Auswirkung auf unsere Bewegungsfreiheit. Aber ich anerkenne, dass sie notwendig ist. Von zu Hause aus zu arbeiten, emfinde ich als sehr schwierig. - Wie wirkt sich die Krise in Ihrem Land auf die verletzlichsten Menschen aus?
Die arme, ausgegrenzte Bevölkerung ist am meisten betroffen. Es fehlt ihr an fast allem. Präsident Bolsonaro verhält sich wie ein Feind der Verletzlichsten und arbeitet aktiv gegen die Behörden und die Gouverneure der Bundesstaaten. - Was werden die Folgen der Coronakrise sein?
Die Wirtschaftskrise, die auf uns zukommt, wird beispiellos sein. Die drängendste Frage wird die Ernährungssicherheit betreffen, aber auch das Fehlen von Arbeitsplätzen, um wieder in Würde zu leben. Psychische Erkrankungen werden zunehmen. - Gibt es auch Anlass zur Hoffnung?
Menschen haben die Fähigkeit, sich neu zu erfinden, das gibt mir Mut. Im Moment ist die Stimmung in Brasilien zwar von einer grossen Entmutigung geprägt, doch der Kampf ist unser täglicher Begleiter.
Sambu Seck, Generalsekretär der Bauernorganisation KAFO, Guinea-Bissau

Sambu Seck
- Wie erleben Sie persönlich die Coronakrise?
Die Pandemie bestimmt mein tägliches Leben, sowohl privat als auch beruflich. Erstmals in meinem Leben fühle ich mich der volkstümlichen Wärme der bäuerlichen Gemeinschaften und ihrer spontanen, liebevollen Art beraubt. - Welche Ihrer Freiheiten wurden eingeschränkt?
Die Behörden haben die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt, um die Ansteckungsgefahr zu mindern. Als aktives Mitglied der Zivilgesellschaft trage ich das mit, meine Arbeit läuft strikt nur noch über digitale Kanäle. - Wie wirkt sich die Krise in Ihrem Land auf die verletzlichsten Menschen aus?
Nur 38% der Bevölkerung hat Zugang zu Gesundheitsdiensten. Unter den Verwundbarsten sät das Coronavirus als unsichtbarer Feind Angst und Schrecken. Unkenntnis über Ursprung und Umgang mit der Bedrohung verheissen nichts Gutes. - Was werden die Folgen der Coronakrise sein?
Die Gefahren einer akuten Nahrungsmittel- und Gesundheitskrise sind offensichtlich. Unsere Wirtschaft hängt stark von der Landwirtschaft ab, insbesondere der Produktion von Cashewnüssen. Der Export ist jedoch völlig zusammengebrochen. - Gibt es auch Anlass zur Hoffnung?
Guinea-Bissau hat relativ schnell mit präventiven gesundheitlichen und wirtschaftlichen Massnahmen auf diese globale Krise reagiert. Je besser wir alle zusammenstehen, desto eher wird ein schrittweiser Ausweg aus der Krise möglich sein.
Risa Hontiveros, Senatorin im philippinischen Parlament, Manila

Risa Hontiveros
- Wie erleben Sie persönlich die Coronakrise?
Auch die Philippinen setzen die sozialen Distanzierungs- und Quarantänemassnahmen strikt um. Das bedeutet u.a., dass ich mich aus der Ferne um meine alte Mutter kümmern muss. Auch andere geliebte Menschen habe ich seit Wochen nicht mehr gesehen. - Welche Ihrer Freiheiten wurden eingeschränkt?
An erster Stelle ist klar die Einschränkung der Bewegungsfreiheit zu erwähnen. Als Staatsangestellte bin ich davon allerdings – wie das Personal im Gesundheitswesen oder im Detailhandel – etwas weniger stark betroffen. - Wie wirkt sich die Krise in Ihrem Land auf die verletzlichsten Menschen aus?
Die Coronakrise trifft die Verwundbarsten am härtesten. Viele Filipinos arbeiten nach dem Prinzip «keine Arbeit, kein Lohn». Trifft Covid-19 eine bereits arme Familie, wird es für sie extrem schwierig, Die Regierung müsste jetzt alles tun, um die Schwächsten zu schützen. - Was werden die Folgen der Coronakrise sein?
Mit der Pandemie endet eine 21-jährige Wachstumsphase, eine Rezession scheint unvermeidlich. Noch mehr beunruhigt mich die Aushöhlung der Demokratie, die Unterdrückung der bürgerlichen Freiheiten und der Menschenrechte. Der Überwachungsstaat ist auf dem Vormarsch. - Gibt es auch Anlass zur Hoffnung?
Es war und ist herzerwärmend zu sehen, wie sich die Filipinos gegenseitig helfen. Hoffnung gibt mir auch, wie sie landesweit gegen die Abschaltung eines populären TV-Kanals protestierten. Auch der Kampf gegen die Offshore-Glücksspielindustrie geht weiter. Filipinos verteidigen ihre Rechte.
Artikel teilen
Artikel
150 Mio USD für Klima statt für Entwicklung
20.08.2020, Internationale Zusammenarbeit
Der Bundesrat hat am 19. August 2020 beschlossen, 150 Millionen US-Dollar aus dem künftigen Rahmenkredit der Entwicklungszusammenarbeit an den Grünen Klimafonds zu überweisen. Alliance Sud kritisiert diese Zweckentfremdung von Entwicklungsgeldern.

von Jürg Staudenmann, ehemaliger Fachverantwortlicher «Klima und Umwelt»
Kein Zweifel: Gerade in Entwicklungsländern werden Klimaschutz und Anpassung an die Klimaveränderung je länger desto dringender. Dafür lenkt die Schweiz ebenso dringend benötigte Entwicklungsgelder um. Das widerspricht nicht nur klar dem Pariser Klimaübereinkommen, es läuft auch den Grundätzen wirkungsvoller Entwicklungszusammenarbeit (EZA) zuwider. Dabei hat Alliance Sud schon mehrfach aufgezeigt, wie bereits heute die nötigen Gelder nach dem Verursacherprinzip bereitgestellt werden könnten.
Die steigenden Kosten für dringende Klimaschutz- und Anpassungsmassnahmen im globalen Süden verlangen nach zusätzlichen Mitteln. Für die Wiederauffüllung des Grünen Klimafonds (Green Climate Fund), der Klimaprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern finanziert, wurde deshalb eine Verdopplung der Einlagen der Industrieländer erwartet. Während das einige Länder auch zugesagt haben, will die Schweiz ihren Beitrag nun lediglich um 50% erhöhen. Das ist knausrig und kurzsichtig.
Noch problematischer ist, dass die am 19. August vom Bundesrat gutgeheissenen 150 Millionen USD nicht zusätzlich gesprochen wurden, sondern aus der ohnehin schon zu knapp bemessenen EZA umgelenkt werden. Dieses Geld steht damit nicht mehr für die Kernaufgaben der Entwicklungszusammenarbeit – die Verringerung von Armut und Ungleichheit – zur Verfügung.
Dass Emissionsminderung und Armutsbekämpfung verschiedene Absichten und Zielgruppen haben, leuchtet ein (siehe dazu auch das Positionspapier von Alliance Sud). Denn bei den Ärmsten lassen sich kaum nennenswert Emissionen verringern. Selbst sinnvolle und wirksame Klimaanpassungsprojekte sind auf künftige Bedrohungen der Klimaveränderung ausgerichtet, nicht aber auf die unmittelbare Verbesserung der Lebensumstände der ärmsten Bevölkerung. Das jedoch ist ein Grundsatz guter Entwicklungszusammenarbeit und mithin Voraussetzung für den Einsatz von Entwicklungsgeldern. – Aus genau diesem Grund verlangt das Pariser Klimaübereinkommen „neue und zusätzliche“ Mittel.
Dass die bisherige Schweizer Klimafinanzierung in der Tat zum allergrössten Teil weder Ärmsten noch von der Klimakrise am meisten Gebeutelten zu Gute kommt, hat eine von Alliance Sud in Auftrag gegebene Studie («Der Schweizer Beitrag an die internationale Klimafinanzierung») erst kürzlich aufgezeigt.
Für Alliance Sud ist klar: Klimaschutz zu Lasten der Kernaufgabe der Entwicklungszusammenarbeit geht in die falsche Richtung! Denn es besteht durchaus die Möglichkeit, nach dem Verursacherprinzip erhobene Gelder für internationale Klimafinanzierung einzusetzen. Ein Rechtsgutachten vom Februar 2019 hat dargelegt, dass auch eine Teilzweckbindung von Klima-Lenkungsabgaben dafür sowohl verfassungskonform als auch zielführend wäre.
Alliance Sud kritisiert mit Nachdruck, dass solche Optionen bisher weder von Bundesrat noch vom Parlament in Betracht gezogen wurden. Denn internationaler Klimaschutz auf Kosten der Entwicklungszusammenarbeit zu finanzieren, ist der falsche Weg.
Artikel teilen
Artikel
«Lokale Bevölkerung kennt Bedürfnisse am besten»
05.10.2020, Internationale Zusammenarbeit
Nach einem EDA-Diplomaten, der am Ende seiner Berufslaufbahn stand, leitet seit dem 1. Mai Patricia Danzi die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA). Im «global»-Gespräch setzt sie erste Schwerpunkte.

global: Sie arbeiteten zuletzt als Afrika-Verantwortliche für das IKRK, jetzt sind Sie für die humanitäre Hilfe (HH) und die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) der Schweiz verantwortlich. Wie verhalten sich HH und EZA zueinander?
Patricia Danzi: Das hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert und entwickelt. Konflikte dauern länger, der Klimawandel, ein Thema mit enormen Auswirkungen, ist hinzugekommen. Die HH lässt sich mit der Feuerwehr vergleichen; es muss schnell gehen, um einen Brand zu löschen. Wenn Konflikte jedoch andauern und ungelöst bleiben, dann stellen sich beim Wiederaufbau andere Fragen als etwa bei einem Erdbeben oder einer Flutkatastrophe. Man kann nicht über Jahre mit Wasser-Tankwagen in einem Lager mit Vertriebenen vorfahren. In einem solchen Fall braucht es Lösungen, wo HH und EZA zwingend Hand in Hand arbeiten müssen. Zwar sind die Aufgaben, die nötigen Kompetenzen von HH und EZA unterschiedlich, aber die Ziele müssen unbedingt und immer aufeinander abgestimmt sein.
Aufgrund ihrer Erfahrung beim IKRK gibt es Befürchtungen, die humanitäre Hilfe liege Ihnen näher als die langfristige bilaterale Entwicklungszusammenarbeit...
Das soll später einmal beurteilt werden (lacht). Im Ernst: Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit Menschen vor Ort kenne ich den Zusammenhang zwischen kurzfristiger Nothilfe und langfristiger Entwicklungsarbeit sehr gut. Die Prioritäten von Menschen in unmittelbarer Notlage können sich schnell in Richtung existentieller, längerfristiger Probleme wie Ausbildung oder Arbeit verschieben. Ich habe in meiner bisherigen Tätigkeit die Grenzen erlebt, an welche die Nothilfe zwangsläufig stösst, und suchte eine neue, darüber hinausgehende Herausforderung.
Wenn ein fragiler Staat wie Burkina Faso, wo die Schweizer EZA seit Jahren erfolgreich engagiert ist, immer mehr mit interner Gewalt und Vertreibungen konfrontiert ist, wenn Schulen und Gesundheitseinrichtungen aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müssen, dann ist leider auch wieder der Einsatz von HH gefragt; gerade auch, um das bereits durch die EZA Erreichte zu schützen. So oder so muss die Bevölkerung immer in unsere Arbeit einbezogen sein, denn sie weiss mit Abstand am besten, welche Bedürfnisse sie kurz- und längerfristig hat.
Die Qualität der HH misst sich an ihrer Fähigkeit zur raschen Reaktion in der Krise. Gibt es auch einen so prägnanten und wahren Satz zur EZA?
Gute EZA ist längerfristig aufgestellt, nur so kann sie ihre Wirkung entfalten. Sie erzielt auf vielleicht weniger spektakuläre, aber nachhaltige Weise die gewünschten Ergebnisse. In einigen Ländern ist die DEZA schon seit Jahrzehnten vertreten und hat, so berichten es mir die Schweizer BotschafterInnen dort, den Ruf einer transparenten und verlässlichen Partnerin.
Wie kann man der Gefahr entgegenwirken, dass eine Entwicklungsagentur wie die DEZA eine Rolle übernimmt, die eigentlich die betroffenen Staaten selbst hätten?
Es gilt immer und überall, gute Regierungsführung einzufordern. Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei die Zivilbevölkerung, die junge Bevölkerung etwa, die ganz anders mit den digitalen Möglichkeiten, mit den sozialen Medien umzugehen weiss. Zwar braucht es ein gewisses Mass an Freiheit, damit die Bevölkerung selbst eine Kontrollfunktion ausüben kann. Doch wenn die Leute etwa wissen, dass die Schweiz zwei Millionen für den Bau eines Spitals gesprochen hat, und es geht mit dem Bau nicht vorwärts, dann werden sie sich wehren. Das ist heute anders als noch vor zwanzig Jahren. Auch in dieser Beziehung ist Transparenz ein entscheidender Faktor.
In den letzten Jahren ist die messbare Wirkung der EZA immer wichtiger geworden. Geldgeber wie auch die Steuerzahlenden wollen wissen, was ihr Geld bewirkt.
Das stimmt, heute muss man nicht bloss nachweisen, wie viele Moskitonetze verteilt wurden, sondern auch, wie stark dadurch die Verbreitung der Malaria abgenommen hat, am besten detailliert aufgeschlüsselt nach Region, Altersgruppen und Geschlechtern. Ich verstehe diesen Wunsch nach Rechenschaft über unsere Arbeit. Es ist auch ganz wichtig, dass wir Situationen genau analysieren, bevor wir aktiv werden. Aber gleichzeitig ist es schwierig zu messen, welche Probleme dank unserer Arbeit nicht aufgetreten sind, dank Prävention zum Beispiel. Wenn man in gute Regierungsführung oder in die Beteiligung der Zivilgesellschaft an Entscheidungsprozessen investiert, dann ist das Ergebnis schwierig zu messen.
Auch nicht direkt Messbares kann also ausgesprochen relevant sein?
Ja, darum ist es so wichtig, anhand von konkreten Beispielen zu erklären, welche Bedeutung etwa der Aufbau von Netzwerken hat. Es lässt sich selbstverständlich belegen, wenn wir zum Beispiel so und so viele Leute ausgebildet haben, die in einer Gemeinschaft eine wichtige Rolle innehaben. Will man aber in einem Land die Rechtsstaatlichkeit fördern – und das gehört genauso zu unseren vordringlichen Anliegen wie gute Regierungsführung – ist das schwieriger messbar, dann muss man konsequent darauf hinarbeiten und es unserer Öffentlichkeit entsprechend erklären. Und meine Erfahrung ist, dass das durchaus auch verstanden wird.
Die Beratungen im Parlament zur neuen Botschaft über die internationale Zusammenarbeit (IZA) der nächsten vier Jahre sind abgeschlossen. Wie haben Sie die Debatte erlebt?
Die Coronakrise hat die IZA nicht in Frage gestellt, unser Budget für 2020 wurde sogar noch leicht erhöht. Es freut mich, dass die Einsicht so klar war, dass in einer schwierigen Zeit bestehende Systeme gestärkt und nicht durch Einsparungen geschwächt werden sollen. Die Diskussionen im Parlament waren inhaltlich spannend, für mich war es ein gutes Zeichen, dass ParlamentarierInnen wirklich verstehen wollen, was auf dem Spiel steht.
Die Bedürfnisse sind aufgrund der Coronakrise stark angestiegen. Wäre es nicht endlich Zeit, dass die Schweiz ihre Entwicklungsausgaben auf den internationalen Zielwert einer APD-Quote von 0.7% des Nationaleinkommens erhöht?
Klar würde ich es persönlich begrüssen, wenn wir mehr Geld für unsere wichtige Arbeit zur Verfügung hätten. Aber ich finde, eine starre Quote ist – gerade heutzutage – auch problematisch, je nach Wirtschaftsgang führten die laufenden Anpassungen zu starken Schwankungen beim tatsächlich zur Verfügung stehenden Budget. In Grossbritannien etwa führt das zu grossen Unsicherheiten in der Planung mit den Partnerländern. In der Schweiz gehen wir von mehr oder weniger stabilen Beiträgen für die EZA aus. Mir ist es lieber, mit festen Geldbeträgen als mit Prozentsätzen zu planen.
Wie wird die Pandemie die Arbeit der DEZA beeinflussen oder verändern?
Wir wollen dort, wo wir jetzt engagiert sind, möglichst präsent bleiben. Und dies nicht zuletzt darum, weil sich andere Länder mit grösseren Budgets wegen der Pandemie zurückziehen. Das wird den Erwartungsdruck auf uns erhöhen. Wir gehen davon aus, dass gerade Länder, in denen in den letzten Jahren eine Mittelklasse entstanden ist, durch die Pandemie starke Rückschläge erleiden werden. Neu geschaffene Arbeitsplätze gehen wieder verloren, viele Menschen werden in den verletzlichen informellen Sektor zurückgeworfen. Wir werden sicher nicht weniger Arbeit haben, im Gegenteil. Dabei wollen wir möglichst nahe bei den von der Krise betroffenen Menschen sein; es reicht nicht, im Büro in Bamako, Bischkek oder Addis Abeba zu sein, um die Bedürfnisse der Leute wirklich zu kennen.
Alliance Sud kritisiert den geplanten Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Privatsektor in der neuen IZA-Botschaft. Können Sie zum jetzigen Zeitpunkt mehr dazu sagen, nach welcher Strategie das geschehen soll?
Das ist ein Thema, das mich sehr interessiert und beschäftigt, auch DEZA-intern spüre ich ein zunehmendes Interesse. Wir arbeiten auf Hochtouren daran zu präzisieren, wie diese Zusammenarbeit mit dem Privatsektor konkret aussehen soll. Im Zentrum steht dabei die Wirkung, die wir erzielen wollen. Wie lassen sich staatliche und Mittel aus der Wirtschaft so kombinieren, dass die Bevölkerungen vor Ort eindeutig davon profitieren? Wie bringen wir grössere und auch mittelgrosse Firmen – auch solche aus dem Süden – dazu, Arbeitsplätze in Ländern zu schaffen, in denen das wirtschaftliche Umfeld dafür nicht ideal ist? Und wie kann dies realisiert werden, ohne bestehende lokale Strukturen zu schädigen? Wir haben im Sommer Leitlinien entwickelt, die diese Risiken ernst nehmen und definieren, unter welchen Bedingungen wir uns eine Zusammenarbeit mit dem Privatsektor vorstellen können. Oder eben nicht. Diese Unterlagen sind zurzeit beim Departementschef, bis Ende Jahr werden wir informieren, wie es diesbezüglich weitergeht.
Grosse Konzerne sind nicht gerade bekannt für die von Ihnen postulierte Transparenz...
Kein Geheimnis ist, dass der Privatsektor primär Profit machen will. Wenn wir mit dem Privatsektor zusammenarbeiten, dann mit dem gemeinsamen Ziel, die nachhaltige Entwicklung zu fördern. Wie können wir sicherstellen, dass gewisse Teile der Bevölkerung nicht durch die Maschen fallen? Diese Diskussionen sind nicht einfach zu führen; ich habe aber den Eindruck, dass die Bereitschaft des Privatsektors, soziale und ökologische Aspekte in einer langfristigen Perspektive zu berücksichtigen, gewachsen ist.
Verstehen Sie persönlich die Befürchtung, dass mit dieser Strategie die Bedürfnisse der ärmsten Bevölkerungsschichten oder die Stärkung der Zivilgesellschaft im Süden vernachlässigt werden könnte?
Ja, ich kann diese Befürchtungen nachvollziehen. Aber ich kenne auch den dringenden Wunsch der armen Länder und der verletzlichsten Schichten nach mehr sicheren Arbeitsplätzen. Und die sind ohne Einbezug – auch des finanzkräftigen – Privatsektors kaum zu schaffen. Darüber hinaus: Wenn es uns gelingt, durch Dialog oder Partnerschaften mit dem Privatsektor zur Verbesserung von sozialen oder ökologischen Standards und Geschäftspraktiken beizutragen, dann ist einiges gewonnen. Ohne diesen Dialog verpassen wir die Chance, wirklich etwas bewegen zu können.
Mehr IZA-Gelder sollen auch in die internationale Klimafinanzierung fliessen – obwohl das Pariser Klimaabkommen dafür neue und zusätzliche Gelder verlangt. Eine Studie von Alliance Sud zeigt, dass Klimafinanzierung bisher vor allem in Länder mittleren Einkommens eingesetzt wurde. So bleibt doch immer weniger Gelder für die Armutsreduktion übrig?
Es wäre sicher nicht falsch, wenn wir zusätzliche Gelder für die Klimafinanzierung hätten. Tatsache ist, dass wir mit unseren Mitteln in den Ländern mittleren Einkommens für den Klimaschutz oft am meisten Wirkung erzielen können, dort wo notabene die Ungleichheit häufig sehr gross ist. Wir müssen allerdings noch besser sicherstellen, dass wir dort auch die am stärksten von der Klimaveränderung Betroffenen – das sind vielfach die Ärmsten – erreichen.
Mir ist völlig klar, wie dramatisch sich die Verhältnisse wegen der Klimaveränderung in kürzester Zeit verändert haben. Letztes Jahr traf ich in Somalia vertriebene Viehzüchter, die rund um einen Brunnen Getreide anbauten, wofür sie Saatgut erhalten hatten. Sie wünschten sich aber wieder Ziegen und Kamele, obwohl sie wussten, dass diese vielleicht keine fünf Jahre mehr überleben würden. Wenn ganze Bevölkerungen ihre Lebensweise neu ausrichten müssen, dann ist das eine enorme Herausforderung für sie – aber auch für uns und unsere Arbeit.
Wie kommen Sie persönlich mit diesen fast unlösbaren Aufgaben zurecht?
Bescheidenheit und Demut sind wichtig. Wir haben Expertise, aber keine fertigen Lösungen, weder die DEZA noch andere Entwicklungsagenturen. Darum braucht es auch die multilaterale Zusammenarbeit so dringend, damit man die enormen Probleme gemeinsam multiperspektivisch angehen und gemeinsam eine Vision erarbeiten kann. Dabei gibt es keine einfachen Lösungen mehr. Wichtig ist für mich, dass man sich immer vor Ort mit den Betroffenen über ihre Bedürfnisse auseinandersetzt.
Alliance Sud verlangt von der Schweizer Politik mehr Kohärenz bei der Lösung dieser enormen Probleme. Dazu gehört nicht nur die Entwicklungs-, sondern zum Beispiel auch die Steuer- und die Handelspolitik. Wie sehen Sie das?
In diesem Bereich bleibt einiges zu tun, wie Konsultationen zur IZA-Strategie gezeigt haben. Ich denke, es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Zivilgesellschaft, auf diese Zusammenhänge hinzuweisen. Die Aufgabe der DEZA ist es primär, die Kohärenz unserer eigenen Strategie zu garantieren. Und im Austausch und Dialog mit anderen Bundesämtern immer wieder auf das wichtige Thema Politikkohärenz hinzuweisen.
Patricia Danzi
Patricia Danzi (51) ist als Tochter einer Schweizerin und eines Nigerianers im Kanton Zug aufgewachsen. Sie hat Geografie sowie Agrar- und Umweltwissenschaften studiert und arbeitete seit 1996 beim IKRK, wo sie die letzten fünf Jahre die Regionaldirektion Afrika leitete.
Artikel teilen
Meinung
Nicht aufgeben lohnt sich
05.10.2020, Internationale Zusammenarbeit
2019 berichtete «global» über die Schweizer Agrarfirma GADCO in Ghana. Die Verantwortlichen wehrten sich gegen die Darstellung. Gastautor Holy Kofi Ahiabu, der ghanaische Mitarbeiter von Alliance Suds Kristina Lanz wurde eingeschüchtert.

Holy Kofi Ahiabu
von Holy Kofi Ahiabu
Seit 2014 arbeitete ich mit an mehreren von Kristina Lanz durchgeführten Studien über die Auswirkungen des GADCO-Landerwerbs auf Dörfern in der Volta-Region ganz im Süden Ghanas. Die Ergebnisse unserer Arbeit wurden mit den DorfbewohnerInnen sowie FirmenvertreterInnen und VertreterInnen der lokalen Autoritäten mehrmals an öffentlichen Versammlungen diskutiert. Die Menschen beklagten sich unter anderem, dass ihnen GADCO ihr Ackerland ohne angemessene Entschädigungen abgeluchst habe, dass Fischteiche und Trinkwasserquellen zerstört, der Zugang zu Brennholz erschwert worden seien, dass Zufahrtswege blockiert und die Landbevölkerung schikaniert wurde, die gegen den Verlust ihres Farmlands protestierte.
Unser Ziel war es immer, Lösungen für die Probleme zu finden, die unsere Forschung aufgedeckt hat. Auch nach Abschluss der Forschungsarbeiten besuchte ich die Gemeinden häufig, um zu sehen und zu hören, wie sich die Dinge verändert haben – leider meist zum Schlechten. Zusammen mit einer Kollegin von Brot für alle nahm Kristina Lanz schliesslich Kontakt mit dem Schweizer Eigentümer von GADCO auf. Viele der Probleme sind kurz- bis mittelfristig nicht zu lösen; also beschlossen wir, vom GADCO-CEO den Bau einer Brücke über den von der Firma gebauten Kanal zu fordern. Ohne eine solche Brücke bliebe das Dorf Kpevikpo von seinen Nachbargemeinden abgeschnitten. Wenn der Kanal Wasser führte, konnten Kinder nicht mehr zur Schule, Frauen nicht mehr zum Markt gehen, die Menschen hatten keinen Zugang mehr zu sozialen Diensten oder konnten nicht an Versammlungen teilnehmen.
Schliesslich erklärte sich der GADCO-CEO bereit, an einem von mir organisierten Gemeindetreffen in Kpevikpo teilzunehmen. Er sollte mich am besagten Tag in der naheliegenden Stadt Sogakofe abholen, damit ich ihn zu dem Treffen führen konnte. Anstatt nach Kpevikpo wurden wir jedoch zum GADCO-Büro gefahren. Zu meiner Überraschung warteten dort mehrere Vertreter der traditionellen Dorfautoritäten, die mit GADCO gemeinsame Sache gemacht hatten; ich wurde als Drahtzieher von Kristina Lanz‘ «global»-Artikel beschimpft und wegen meiner Teilnahme an den Forschungen verunglimpft. Kristina ihrerseits erhielt einen Brief von den Chiefs, in dem unsere Forschung diskreditiert und uns beiden mit rechtlichen Schritten gedroht wurde.
Nach dem Treffen ging es zusammen mit den Chiefs doch noch zum Gemeindetreffen, wo der GADCO-CEO schliesslich dem Bau der Brücke zustimmte und versprach, jeden Haushalt in Kpevikpo mit Solarpanels zu versorgen. Als Verfechter der nachhaltigen Gemeindeentwicklung wollte ich seither sicherstellen, dass es nicht nur bei Versprechen blieb. Nach vielen Mails und einigem Hin und Her war es im Juli 2020 tatsächlich soweit: Die Brücke wurde gebaut (Bild). Auf die versprochenen Solarpanels warten die Leute allerdings immer noch.
Mein oberstes Ziel bleibt es, für positive Veränderungen einzustehen. Dafür werde ich mich weiterhin einsetzen, auch wenn dies nicht immer einfach ist, da ich dem Risiko von Einschüchterungen ausgesetzt bin und als Einzelperson, die nicht mit einer Organisation verbunden ist, dafür – abgesehen von der temporären Unterstützung aus der Schweiz – auch nicht bezahlt werde.
Der Autor, Holy Kofi Ahiabu ist Forschungsassistent und verteidigt eine nachhaltige Gemeindeentwicklung in Sogakofe, Region Volta, Ghana
Artikel teilen

