Artikel teilen
Artikel
Verkehrte Welt: Zölle für die ärmsten Länder
05.05.2025, Handel und Investitionen
US-Präsident Donald Trump bringt Alliance Sud mit seinen Zoll-Eskapaden in eine paradoxe Lage: So muss sie ständig betonen, dass diese Zölle für die Länder des Globalen Südens verheerend sind... Dabei hat Alliance Sud doch stets deren Recht verteidigt, sich durch Zölle zu schützen. Die USA aber sind ein Schwergewicht des Welthandels, das seit dreissig Jahren dem gesamten Planeten ein offenes Handelssystem aufzwingt.

Die Einführung von Zöllen, wie sie Donald Trump vorschwebt, wäre für Lesotho eine Katastrophe. Die Textilindustrie des afrikanischen Kleinstaats produziert hauptsächlich für den US-amerikanischen Markt, wie in dieser Fabrik für Levis-Jeans in Maseru. © Keystone / EPA / Kim Ludbrook
Dass der US-Präsident eine 90-tägige Pause angeordnet hat und sich vorderhand auf einen allgemeinen Zollsatz von 10% beschränkt – mit Ausnahme von China, gegen das er de facto ein Embargo verhängt hat (145%) – nimmt dem Thema nicht die Brisanz. UN Trade and Development (ehemals UNCTAD) fordert die sofortige Aufhebung dieser Zölle und unterstreicht deren Absurdität: In einem am 14. April veröffentlichten Bericht verweist die UN-Organisation darauf, dass von den 57 Ländern, die von reziproken Zöllen bedroht sind, 11 zu den am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs) gehören. Weiter wird festgestellt, dass 28 der gelisteten Länder zusammen gerade einmal 0,625% zum US-Handelsdefizit beitragen.
Die Theorie der komparativen Vorteile
Derzeit wird das internationale Handelssystem auf den Kopf gestellt. Dabei waren seit der Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) im Jahr 1995 die USA stets treibende Kraft hinter der neoliberalen Globalisierung. Diese fusste auf einer umfassenden Liberalisierung des Welthandels und folglich einem allgemeinen Zollabbau. Nach diesem Modell sollte jedes Land gemäss dem Grundsatz komparativer Vorteile agieren, also jene Produkte exportieren, bei denen die niedrigsten Produktionskosten anfallen. Die resultierende internationale Arbeitsteilung führt de facto dazu, dass die Länder des Globalen Südens Rohstoffe exportieren und fertige Industrieprodukte aus dem Norden importieren.
Die Hälfte der afrikanischen Länder ist vom Rohstoffexport abhängig
Infolgedessen ist auch heute noch «die Hälfte der afrikanischen Länder von Rohstoffen abhängig (in mindestens 60% der Länder sind es Öl, Gas und Erze). Auf Afrika entfallen zwar nur 2,9% des internationalen Handels, aber dort leben 16% der Weltbevölkerung, und diese Zahl wird künftig noch steigen», gab Rebeca Grynspan, Generalsekretärin von UN Trade and Development am 10. Februar in Abidjan bei der Vorstellung des Berichts 2024 über die wirtschaftliche Entwicklung in Afrika zu bedenken.
Da aber der alleinige Export von Rohstoffen kein ausreichender Entwicklungstreiber ist, unterstützt Alliance Sud das Recht der Länder des Globalen Südens, sich den nötigen Spielraum zu verschaffen, um ihre Landwirtschaft und Industrie zu schützen, auch mithilfe von Zöllen. Ohne Zölle und weitere Schutzmassnahmen hätte sich in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern gar keine Industrie entwickeln können. Davon zeugen die Erfolgsgeschichten von Ländern wie Südkorea oder China.
Keine Zölle auf Kakao, dafür auf Schokolade
Kenia ist ein sehr gutes Beispiel für die Politik der Importsubstitution. Vor etwa 15 Jahren nahm ich in Nairobi an einer Pressekonferenz von Nestlé teil, an der das Unternehmen seine Absicht ankündigte, in die Milchproduktion vor Ort einzusteigen. Der Grund dafür war, dass das Land über Nacht beschlossen hatte, in Übereinstimmung mit den WTO-Regeln die Zölle auf importiertes Milchpulver zu erhöhen. Infolgedessen war es für Nestlé nicht mehr rentabel, das Milchpulver Milo nach Kenia zu exportieren. Der Lebensmittelmulti aus Vevey investierte daher in die gesamte Produktionskette der Milchwirtschaft und unterstützte Gross- und Kleinbauern dabei, sich in Genossenschaften zu organisieren. Trotz des Risikos der Marktbeherrschung durch einen einzigen grossen Akteur hat sich Kenia von einem Land, das Milch importiert, zu einem Land entwickelt, das genug Milch produziert, um seinen Bedarf zu decken.
Abgesehen von einigen Ausnahmen besteht das seit 30 Jahren von der WTO, dem Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank und den Ländern des Nordens (angeführt von den USA) vorgegebene Modell jedoch darin, die Entwicklungsländer zu Zollsenkungen zu drängen und sich auf einige wenige Exportprodukte zu beschränken. Bangladesh ist hierfür ein Paradebeispiel: Es bezieht den Löwenanteil seiner Einnahmen aus dem Textilexport (die katastrophalen Arbeitsbedingungen und die Hungerlöhne in diesem Sektor klammern wir hier einmal aus). Im Jahr 2023 machte dieser Zweig 10% des Bruttoinlandprodukts aus, grösster Abnehmer waren die USA.
In die Schweiz und die EU können die LDCs Rohstoffe wie Kakao kontingent- und zollfrei exportieren. Auf verarbeitete Agrarprodukte wie Schokolade werden jedoch Zölle erhoben, was der Wertschöpfung in Ursprungsländern wie der Elfenbeinküste und Ghana nicht dienlich ist.
AGOA in den USA in der Schwebe
Die USA gewähren nicht allen LDCs die gleichen Zollvergünstigungen, haben aber im Jahr 2000 mit rund 30 afrikanischen Ländern mit dem Programm Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) vereinbart, dass Tausende von Produkten zollfrei auf den amerikanischen Markt exportiert werden können. Seine Verlängerung im September 2025 ist aber Stand heute alles andere als gesichert.
Beispielsweise hat Lesotho, eines der ärmsten Länder der Welt, von diesem Programm profitiert. Im Jahr 2023 exportierte es vor allem Textilien und Bekleidung in die USA: Deren Wert belief sich auf 168 Mio. USD, davon 166 Mio. im Rahmen des AGOA. Nun wollte Donald Trump dem Land ursprünglich einen Zollsatz von 54% auferlegen, wahrscheinlich mit dem Ziel, das prozentuell unbestritten grosse Handelsdefizit auszugleichen. Im selben Jahr exportierte Washington nämlich Waren im Wert von nur 3,3 Mio. USD nach Lesotho und führte gleichzeitig Güter im Wert von 226,6 Mio. USD ein. Die Einführung solch astronomischer Zölle wäre für den afrikanischen Kleinstaat eine Katastrophe gewesen und hätte im Übrigen auch nicht zu einer Verlagerung der Produktion in die USA geführt: Für die USA ist die Textilherstellung zweifellos keine Alternative (da zu kostspielig) und auch Mineralien wie Diamanten können dort nicht abgebaut werden (über 56 Mio. USD an Importen).
Die USA sind einer von fünf Handelspartnern Afrikas
Deswegen die Schlussfolgerung: Ja, die Entwicklungsländer müssen ihre Industrie und Landwirtschaft durch Zölle schützen können. Gleiches gilt aber nicht für die Grossmacht USA, die dreissig Jahre lang die Speerspitze eines Handelsmodells darstellte, dem sich auch die ärmsten Länder unterwerfen mussten.
Es bleibt die Hoffnung, Donald Trump möge seine Entscheidungen ein für alle Mal revidieren. Gleichzeitig bieten seine Irrungen und Wirrungen den armen Ländern aber auch Gelegenheit, ihr Entwicklungsmodell zu überdenken und sich stärker auf den heimischen und den regionalen Markt zu konzentrieren. Besonders gilt dies für afrikanische Länder, wo die kontinentale Freihandelszone langsam Form annimmt – wobei es auch hier Gewinner und Verlierer geben wird....
Für die afrikanischen Länder wird mithin eine Diversifizierung ihrer Handelspartnerschaften immer dringlicher: Laut UN Trade and Development haben 50% der afrikanischen Länder nur gerade fünf Handelspartner: China, die Europäische Union, Indien, Südafrika und die USA. Als Gegenbeispiel kann Vietnam herangezogen werden, das mit 97 Volkswirtschaften Handel betreibt. Dies veranschaulicht den Spielraum Afrikas, seine Volkswirtschaften zu stärken und zu diversifizieren. Ein Prozess, der durch die aktuellen Turbulenzen beschleunigt werden dürfte.
Handel und Klima
Der CO2-Grenzausgleich darf arme Länder nicht benachteiligen
03.12.2024, Klimagerechtigkeit, Handel und Investitionen
Der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) der Europäischen Union sieht vor, den Import der umweltschädlichsten Produkte zu besteuern. Obwohl die ärmsten Länder dadurch stark benachteiligt werden, ist für sie keine Ausnahme vorgesehen. Sollte die Schweiz das Abkommen eines Tages übernehmen, muss sie für eine Korrektur sorgen.

In Akokan, Niger, schloss eine der weltgrössten Uranerz-Minen. Doch noch sind weitere im krisenreichen Norden geplant und volkswirtschaftlich bedeutend. © Keystone / AFP / Olympia de Maismont
Die Europäische Union (EU) nimmt ihre Klimaverpflichtungen ernst. Im Jahr 2019 hat sie den European Green Deal ins Leben gerufen, der darauf abzielt, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55% zu senken und bis 2050 CO2-neutral zu werden.
Das Programm umfasst mehrere interne und externe Massnahmen, zum Beispiel die Europäische Entwaldungsverordnung (EUDR, siehe global #94). Ein weiteres Schlüsselprojekt der europäischen Handelspolitik ist das CO2-Grenzausgleichssystem (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism). Es zielt darauf ab, Importindustrien denselben Regeln zu unterwerfen wie umweltbelastende europäische Unternehmen, die an eine Emissionsobergrenze gebunden sind – wobei diese Grenze bisweilen nur dank CO2-Emissionshandel eingehalten wird. Das erklärte Ziel dieser Massnahmen ist es, Investitionen in saubere Energie in Europa attraktiver und billiger zu machen. «Der CBAM schafft Anreize für die globale Industrie, umweltfreundlichere Technologien einzuführen», sagt der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.
Carbon Leakage vermeiden
Der von Brüssel verabschiedete CBAM soll verhindern, dass die Produktion in Länder mit Kohlenstoffpreisen unter EU-Niveau (oder gar ohne solche Bepreisung) verlagert wird (Carbon Leakage). Auch soll dadurch vermieden werden, dass europäische Hersteller einem unfairen Wettbewerb ausgesetzt werden. Der Mechanismus sieht vor, die Einfuhr von besonders umweltschädlichen Produkten mit einer Abgabe zu belegen. Zunächst sind dies Eisen und Stahl, Zement, Düngemittel, Aluminium, Wasserstoff und Elektrizität.
In der EU seit dem 1. Oktober 2023 in Kraft, wird der CBAM gestaffelt umgesetzt. Für 2026 ist die vollständige Einführung geplant. Ab 2031 soll er dann auf alle importierten Produkte angewandt werden.
Kritik aus dem Globalen Süden
Doch welche Wirkung hat diese Massnahme? Die EU gibt sich optimistisch: Sie schätzt, dass dadurch im Vergleich zu 1990 ihre Emissionen bis 2030 um 13,8% und im Rest der Welt um 0,3% sinken werden.
Der Ansatz wird jedoch von den Ländern des Globalen Südens stark kritisiert. Sie beurteilen ihn als entwicklungshemmend. Andere monieren das Fehlen einer generellen Ausnahme, zumindest für die ärmsten Länder. Ausserdem hat die UN Trade and Development (ehemals UNCTAD) errechnet, dass die Auswirkungen auf das Klima minimal sein dürften: Der CBAM werde die globalen CO2-Emissionen nur um 0,1% senken, jene der EU gerade einmal um 0,9%. Er werde aber voraussichtlich das Einkommen der Industrieländer um 2,5 Mrd. USD erhöhen und jenes der Entwicklungsländer um 5,9 Mrd. USD reduzieren.
2022 forderten die Minister von Brasilien, Südafrika, Indien und China, auf diskriminierende Massnahmen wie einen CO2-Grenzausgleich zu verzichten.
Am stärksten betroffen von diesem Mechanismus sind mit Russland, der Türkei, China, Indien, Südafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten jene Schwellenländer, die am meisten Stahl und Aluminium nach Europa exportieren. Doch auch die am wenigsten entwickelten Länder (LDCs gemäss UN-Kategorisierung) wie Mosambik (Aluminium) und Niger (Uranerz) sind Leidtragende des Mechanismus. Die Wohlfahrtsverluste für Entwicklungsländer wie die Ukraine, Ägypten, Mosambik und die Türkei würden zwischen 1 und 5 Milliarden Euro betragen, was gemessen an ihrem Bruttoinlandprodukt (BIP) beträchtlich ist.
Eine Ausnahme für LDCs?
Werfen wir einen Blick nach Afrika, wo sich 33 der 46 LDCs befinden. Eine aktuelle Studie der London School of Economics kommt zum Schluss, dass das Bruttoinlandprodukt (BIP) Afrikas mit Anwendung des CBAM auf alle Importprodukte um 1,12% oder 25 Milliarden Euro sinken würde. Die Aluminiumausfuhren gingen um 13,9% zurück, die Eisen- und Stahlexporte um 8,2%, die Düngemittelausfuhren um 3,9% und die Zementausfuhren um 3,1%.
Also das Kind mit dem Bade ausschütten und den CBAM für entwicklungsfeindlich erklären? Das ist wahrscheinlich der falsche Ansatz. Die belgische NGO 11.11.11. schlägt vor, die am wenigsten entwickelten Länder zumindest vorerst nach den WTO-Regeln von diesem Mechanismus auszunehmen, beziehungsweise sie weniger stark zu besteuern als andere. Anlässlich der Diskussionen zum CBAM in Brüssel war diese Möglichkeit vom Parlament in Betracht gezogen worden. Sie wurde aber verworfen, da die EU es vorzog, höhere Einnahmen zu erzielen.
UN Trade and Development hingegen machte den Vorschlag, die Einnahmen aus dem Mechanismus an die LDCs weiterzugegeben, mit dem Zweck, deren Klimatransition zu finanzieren. Die erwarteten Einnahmen der EU belaufen sich auf 2,1 Milliarden Euro, die multilateral über den derzeit unterfinanzierten Grünen Klimafonds weitergeleitet werden könnten.
Vorerst kein CBAM für die Schweiz
In der Schweiz existiert derzeit nichts dergleichen. Heute sind Güter schweizerischen Ursprungs, die in die EU exportiert werden, aufgrund des Emissionshandelssystems (ETS) vom CBAM befreit und der Bundesrat verzichtet derzeit darauf, einen solchen Mechanismus für in die Schweiz importierte Produkte einzuführen. Dem ETS liegt die maximale Menge an Emissionen zugrunde, die den Industrien eines Wirtschaftszweigs zur Verfügung steht. Jedem Teilnehmer wird eine bestimmte Menge an Emissionsrechten zugeteilt. Bleiben seine Emissionen unter dieser Grenze, kann er seine Rechte verkaufen. Übersteigen sie diese Grenze, kann er welche erwerben.
Im März 2021 wurde jedoch im Nationalrat eine parlamentarische Initiative eingereicht, die von der Schweiz eine Anpassung der CO2-Gesetzgebung fordert. Darin soll ein CO2-Grenzausgleichsmechanismus aufgenommen und dabei die Entwicklung in der EU berücksichtigt werden. Derzeit wird diese parlamentarische Initiative noch in den Kommissionen diskutiert.
Der CBAM kann zwar eine wirksame Handelsmassnahme sein, um importierte CO2-Emissionen zu reduzieren. Sollte die Schweiz das System eines Tages einführen, muss sie jedoch darauf achten, dass sie die ärmsten Länder nicht bestraft. Sie muss ihnen Ausnahmen gewähren und einen erheblichen Teil der erzielten Einnahmen zurückerstatten, um ihnen bei der Energietransition zu helfen.
Die Treibhausgasemissionen, die durch die Produktion und den Transport von exportierten und importierten Waren und Dienstleistungen entstehen, machen 27% der weltweiten Treibhausgasemissionen aus. Gemäss der OECD stammen diese Emissionen aus sieben Wirtschaftszweigen: Bergbau und Energiegewinnung, Textilien und Leder, nichtmetallische Chemikalien und Bergbauerzeugnisse, Grundmetalle, elektronische und elektrische Erzeugnisse, Maschinen, Fahrzeuge und Halbleiter.
Es ist unbestritten, dass sowohl auf Seiten des Handels wie auch der Produktion Handlungsbedarf besteht – auf der Produktionsseite beispielsweise durch die Förderung grüner Technologien, Technologietransfer und Klimafinanzierung, auf der Handelsseite durch Massnahmen wie den CBAM. Dessen Einführung darf jedoch die LDCs nicht benachteiligen; diese müssen dabei unterstützt werden, die ökologische Transition zu stemmen und sich an neue Standards anzupassen.
Artikel teilen

global
Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.
Welthandel
Grüner Kolonialismus oder Entwicklungschance?
21.06.2024, Handel und Investitionen
Mit einer Verordnung wird die Einfuhr jener sieben Produkte in die EU verboten, die den grössten Anteil an der globalen Abholzung haben. Es muss sichergestellt werden, dass den Kleinproduzent:innen des Globalen Südens keine Nachteile erwachsen.

Ein einziger grüner Baum in den Hügeln der verbrannten und abgeholzten Landschaft in der Nähe von Mae Chaem, Nordthailand. © Keystone / EPA / Barbara Walton
Die neue EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EU Deforestation Regulation, EUDR) wird am 1. Januar 2025 vollständig in Kraft treten. Die sieben Rohstoffe, die den grössten Anteil an der weltweiten Abholzung haben – Kakao, Kaffee, Palmöl, Gummi, Soja, Holz, Rindfleisch – sowie daraus erzeugte Produkte wie Schokolade, Kaffeekapseln, Möbel, Papier oder Autoreifen – dürfen nur dann in die Europäische Union (EU) importiert werden, wenn nachgewiesen wird, dass sie von Anbauflächen stammen, die nach dem 1. Januar 2020 nicht abgeholzt wurden. Weiter muss belegt werden, dass die Rechte der Arbeitnehmer:innen, Antikorruptionsstandards und die Rechte indigener Gemeinschaften nicht verletzt wurden.
Je nachdem, wie hoch das Entwaldungsrisiko ist, werden die Produktionsländer in drei Kategorien eingeteilt und die Produktionsstandorte mit ausgeklügelten technologischen Mitteln wie Geolokalisierung überwacht. Die Verordnung ist Teil des europäischen «Green Deals», der auf einer unumstösslichen Feststellung basiert: Die EU-27 sind nach China die grössten Importeure von Produkten, die zur Entwaldung beitragen. Die Sorgfaltspflicht (also die Pflicht zu garantieren, dass nicht abgeholzt wurde) obliegt sämtlichen Akteuren der Wertschöpfungskette – Produzent:innen, Exporteuren und Importeuren, unabhängig von ihrer Grösse. Je nach Grösse werden jedoch mehr oder weniger strenge Auflagen zur Anwendung kommen.
Laut einer Studie von Krungsri Research View, einem Forschungsinstitut der fünftgrössten Bank Thailands, ist Deutschland von der EUDR am meisten betroffen – es exportiert vor allem Holz, Kautschuk, Rindfleisch und Kakao. Gleich danach folgt China mit seinem Holz- und Kautschuckexport. Unter den Ländern im Globalen Süden stark betroffen sind Brasilien (Kaffee, Soja, Palmöl), Indonesien (Palmöl), Malaysia (Palmöl), Argentinien (Soja, Palmöl, Rindfleisch), Vietnam (Kaffee) und die Elfenbeinküste (Kakao), Thailand (Kautschuk) sowie Guatemala (Palmöl und Kaffee).
Die NGO Fern (Forests and the European Union Resource Network) geht davon aus, dass auch Honduras, Ghana und Kamerun, die besonders von Exporten in die EU abhängig sind, von der Verordnung betroffen sein dürften.
Globaler Süden gegen die EUDR
Die Länder des Globalen Südens kritisieren die Initiative scharf; sie sehen darin versteckten Protektionismus und einen neuen grünen Kolonialismus. Im September 2023 schickten 17 Regierungschef:innen aus Lateinamerika, Afrika und Asien einen Brief an die jeweiligen Präsidierenden der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und des Ministerrats. Darin bedauerten sie den «one-size-fits-all»-Ansatz der EUDR und das mangelnde Verständnis für lokale Besonderheiten.
Tatsächlich werden es vor allem kleine Landwirtschafts- und Produktionsbetriebe schwer haben, der Verordnung zu entsprechen, auch wenn es – abgesehen von einigen Kaffee- und Kakao-Produzent:innen – vor allem die grossen Hersteller und Exporteure schaffen, ihre Produkte auf den europäischen Märkten zu platzieren.
Die negativen Auswirkungen dieser Initiative haben denn auch nicht lange auf sich warten lassen. Wie das International Institute for Environment and Development betont, sind die europäischen Importeure bereits dabei, von äthiopischem Kaffee auf Kaffee aus Brasilien umzusteigen, der sich leichter zurückverfolgen lässt.
In ihrem Handels- und Entwicklungsbericht von 2023 äusserte sich die UNO-Handels- und Entwicklungsorganisation (ehemals UNCTAD) besorgt über die Häufung unilateraler Initiativen wie EUDR und CBAM (die CO2-Ausgleichsabgabe, die von der EU auch auf hochgradig umweltschädliche Produkte wie Aluminium erhoben wird). Sie ist der Ansicht, dass diese Richtlinien gegen den im Pariser Klimaabkommen verankerten Grundsatz der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung verstossen.
Das Beispiel Thailand
Krungsri Research View hat sich besonders mit dem Fall Thailand befasst, der die Ambivalenz der EUDR aufzeigt. Die unter die EUDR fallenden Produkte machen zwar nur 8,3% der Exporte in die EU und 0,7% aller thailändischen Exporte aus, doch ihr Wert ist im Steigen begriffen.
Den Produzenten und Exporteuren von Kautschuk, Holz und Palmöl werden aufgrund der Anpassung an die neuen Vorschriften erhebliche Kosten entstehen; kleine Produzent:innen werden ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren und Thailand läuft Gefahr, aus den globalen Wertschöpfungsketten ausgeschlossen zu werden.
Wenn der Prozess jedoch angemessen begleitet wird, sowohl seitens der Regierung als auch durch die im Rahmen der EUDR vorgesehenen Unterstützungsmassnahmen, kann Thailand gegenüber seinen Konkurrent:innen an Wettbewerbsfähigkeit zulegen und gleichzeitig seine Wälder erhalten.
Auswirkungen auf die Schweiz
Was bedeutet das für die Schweiz? Sie ist indirekt von der neuen Bestimmung betroffen, da jeder Export der sieben genannten Produkte in die EU die Anforderungen der EUDR erfüllen muss. Weiter steht die Schweiz laut Krungsri, was die Auswirkungen betrifft, gar an 17. Stelle, wobei Kakao und insbesondere Kaffee betroffen sind.
Bisher hält der Bundesrat daran fest, das Schweizer Recht nicht an die EUDR anzupassen, solange eine gegenseitige Anerkennung mit der EU nicht möglich ist. Damit soll doppelter Aufwand für die Schweizer Unternehmen vermieden werden. Bis im Sommer soll eine Folgenabschätzung durchgeführt und dann eine Entscheidung getroffen werden.
Auch die Zivilgesellschaft setzt sich mit dem Thema auseinander. Alliance Sud beteiligt sich an einer Arbeitsgruppe, die analysiert, ob und wie die EUDR für die Schweiz angepasst werden könnte, ohne dass den Kleinproduzent:innen in den Ländern des Globalen Südens Nachteile erwachsen. Gegebenenfalls sind flankierende Massnahmen und Schulungen sowie eine Konsultation der lokalen Gemeinschaften notwendig. Es muss verhindert werden, dass der Kampf gegen den Klimawandel auf Kosten des Entwicklungspotenzials des Welthandels geht.
Artikel teilen

global
Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.
Wirtschaftsgeschichte
Was geschah in Bretton Woods? Und was nicht
25.03.2024, Handel und Investitionen
Vor 80 Jahren legten 43 Länder im US-Kurort Bretton Woods die Grundlage für den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank. Oft wird der Konferenz überhöht die ganze Nachkriegsordnung zugeschrieben. Ein neu erschienenes Buch rückt die Perspektiven zurecht.

Der US-amerikanische Finanzminister Fred M. Vinson unterschreibt am 27. Dezember 1947 in Washington, USA, die in Bretton Woods beschlossenen Abkommen. © KEYSTONE / DPA DC /STR
Wenn es ächzt und knirscht im Gebälk der Weltwirtschaft, ist der Ruf nicht weit nach einer «Art Bretton Woods wie nach dem Zweiten Weltkrieg», so stellvertretend Klaus Schwab nach der Corona-Krise. Ein neu erschienenes Buch des Wirtschaftshistorikers Martin Daunton «The Economic Government of the World, 1933 – 2023» erlaubt es, die Bedeutung der Bretton-Woods-Konferenz ins richtige Licht zu rücken.
Der Autor zeigt, dass 1944 nicht eine kohärente Architektur gefunden wurde, die nach dem Krieg nur noch umgesetzt werden musste, um so das Nachkriegs-Wirtschaftswunder loszutreten. Vielmehr wurde dort lediglich ein Suchprozess in Gang gesetzt. Die Nachkriegsordnung wurde noch von ganz anderen Kräften geprägt: Dem Kalten Krieg (in Bretton Woods war die Sowjetunion noch als vollwertige Partnerin vorgesehen gewesen), dem damit verbundenen Marshall-Plan und der ebenfalls damit verbundenen Wiederherstellung der wirtschaftlichen Stellung Deutschlands in Europa. Das System der flexibel an den Dollar gebundenen Währungen, der wiederum einen fixen Wechselkurs zu Gold hatte, funktionierte gar nur von 1958 – 1968 so wie in Bretton Woods vorgesehen.
Der Globale Süden am Katzentisch
Innerhalb der US-Regierung von Franklin D. Roosevelt, dem demokratischen Präsidenten von 1933 bis 1945, gab es eine Fraktion, die den New Deal auch international dachte. Schon Anfang der 40er Jahre schmiedete sie Pläne für eine öffentliche interamerikanische Entwicklungsbank, die Banker der Wall Street entmachten sollte und auf langfristige öffentliche Entwicklungsfinanzierung statt auf private Investitionen setzte. Der Zuständige für Lateinamerika im US-Aussenministerium sagte 1940, dies sollte der Beginn eines Systems sein, in dem «das Finanzwesen im Dienst des Austauschs und der Entwicklung steht (...) in direktem Gegensatz zum früheren System, das auf der Auffassung basierte, dass die Entwicklung und der Handel dem Finanzwesen dienen müssen». Der Widerstand der Wall Street und im Kongress setzte diesen Plänen allerdings vorerst ein Ende, das Thema war aber mit den Diskussionen über eine International Bank for Reconstruction and Development (IBRD, bis heute der offizielle Name der Weltbank) in Bretton Woods gesetzt.
Die Bretton-Woods-Konferenz wurde von den USA und Grossbritannien dominiert und zu einem beträchtlichen Teil schon vorverhandelt. Die Länder des Globalen Südens – soweit schon unabhängig (wie in Lateinamerika) oder teilautonom (wie Indien) – waren aber auch vertreten. Ebenso hatte Australien als damals noch ganz von Rohstoffexporten abhängiges Land dieselben Anliegen. Für ihre Prioritäten war die Konferenz zur Währungs- und Finanzordnung aber nicht das einzige Forum. Bereits 1943 gab es eine Konferenz zu Nahrungsmitteln und Landwirtschaft und im Jahr darauf eine zu Arbeit, an der Australien erfolglos versuchte, Vollbeschäftigung neben Währungs- und Handelsfragen als gleichwertigen Pfeiler der Nachkriegsordnung zu etablieren.
Auf den harten Kern eines internationalen Währungsfonds, der es erlauben sollte, die Währungen der Mitglieder an den Dollar zu binden, der wiederum zu einem fixen Kurs an Gold gebunden war, hatten sich die USA und Grossbritannien bereits geeinigt. Damit sollte eine Stabilität des Währungssystems mit Flexibilität kombiniert werden, die es den Ländern mit Handelsbilanzdefiziten erlauben sollte, ihre Währungen kontrolliert abzuwerten und so Austerität und Arbeitslosigkeit zu verhindern. Flankiert wurde dies von Kapitalverkehrskontrollen, die die Länder vor destabilisierenden Kapitalflüssen schützten. Der US-Verhandlungsführer in Bretton Woods, Harry Dexter White (sein britisches Gegenüber war der Ökonom John Maynard Keynes, dessen wirtschaftspolitischem Denken, dem «Keynesianismus», später die ganze Nachkriegsordnung zugeschrieben wurde) schrieb in einem frühen Entwurf zur Währungsordnung, dass Länder Kapitalflüsse verhindern sollten, die Instrumente der Reichen seien, um «neue Steuern oder Sozialabgaben» zu umgehen.
Das Buch
«The Economic Government of the World, 1933–1923» (Verlag Farrar, Straus and Giroux, erschienen im November 2023, 986 Seiten) führt hinter die Kulissen der Institutionen, die in den letzten neunzig Jahren die Weltwirtschaft geprägt haben. Es ist in der Schweiz im Online-Buchhandel erhältlich (auf Englisch).
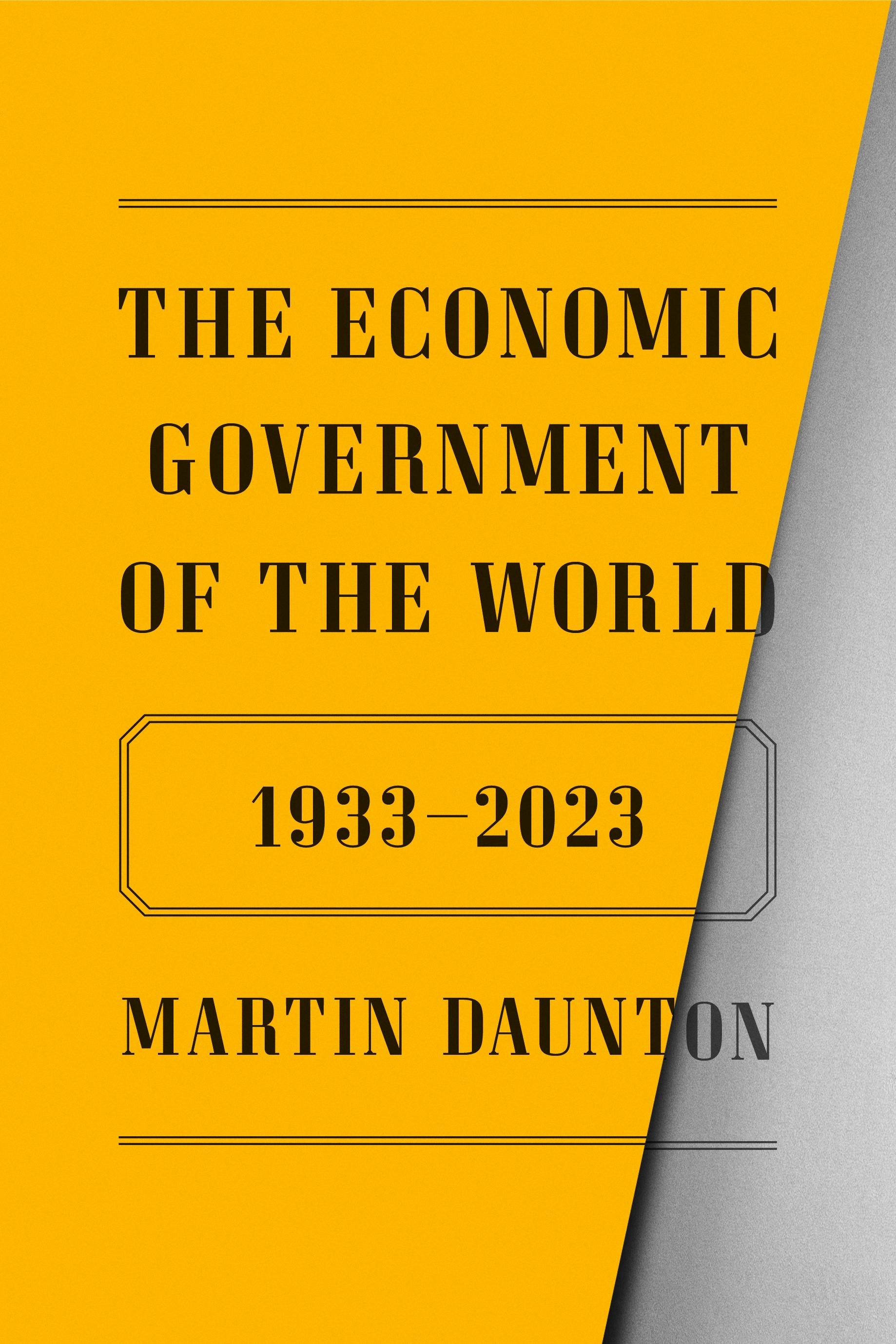
Die USA und Grossbritannien schlugen auch ein Entscheidungsmodell vor, das nach dem Prinzip «one dollar, one vote» an die in den Fonds einbezahlten Gelder gebunden war. So erhielt Grossbritannien ein Übergewicht und die USA eine Vetomöglichkeit. China und Indien, unterstützt von Australien, den lateinamerikanischen Ländern und Frankreich, protestierten erfolglos dagegen. Diese Quotenfrage – die angesichts der veränderten Gewichte in der Weltwirtschaft umso dringender geworden ist – wurde bis heute nicht gelöst.
Lateinamerika war mit 19 Delegationen nach Bretton Woods gereist. Ihre Wortführer betonten die besonderen Probleme mit der Handelsbilanz für Länder, die vom Export von Rohstoffen abhängig sind. Ihnen ging es nicht primär um Währungsfragen, sondern vor allem um die stark schwankenden Preise von mineralischen und agrarischen Rohstoffen. Entsprechend versuchten diese Länder das Mandat des Internationalen Währungsfonds (IWF) um Entwicklungsfragen zu ergänzen: Sie forderten Rohstoffabkommen zur Stabilisierung der Preise und die Möglichkeit, eine eigene Industrie zu fördern und zu schützen, um die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren. Grösstenteils erfolglos, die «Articles of Agreement» des IWF enthalten zwar ein Bekenntnis zu Entwicklung, umgesetzt werden sollte das aber von der IBRD, also der Weltbank.
Nur Wiederaufbau oder auch Entwicklung?
In der Einladung zur Bretton-Woods-Konferenz hatte der Währungsfonds, bei dem «definite proposals» angestrebt wurden, klar Priorität vor einer Bank für den Wiederaufbau. Zentrale Fragen zur Diskussion über die IBRD waren aber für die Delegationen aus dem Globalen Süden hoch relevant. Eine drehte sich darum, ob die Bank primär private Investitionen garantieren oder eigenständig Kredite vergeben sollte. Grossbritannien und die Vertreter der Wall Street wollten eine Bank, die primär private Transaktionen koordiniert und absichert. Dies erstaunt nicht, Grossbritannien war immer noch das wichtigste Finanzzentrum – auch nach dem Krieg wurden 70% der globalen Finanztransaktionen in Sterling abgewickelt –, bevor die Wall Street die Londoner City überholte. Eine zweite Frage drehte sich um das Verhältnis zwischen «Reconstruction» (Wiederaufbau) und «Development» (Entwicklung) im Mandat der Bank. Schliesslich ging es um die damit verbundene Frage, ob die Bank auch Kredite vergeben durfte, die keinen direkten wirtschaftlichen Ertrag abwerfen. Also etwa strukturelle Abwasser- oder Gesundheitsprogramme, die langfristig die Produktivität eines Landes stärken, oder nur konkrete, auch kommerziell interessante Projekte wie etwa ein Kraftwerk. Wer die aktuelle Diskussion über die Weltbank verfolgt, kann sich auch nach 80 Jahren ein «sounds familiar» nicht verkneifen.
Das Ergebnis war ein Kompromiss, der Wiederaufbau und Entwicklung der Mitglieder der IBRD auf die gleiche Stufe stellte. Bei den anderen Fragen gab es allerdings kaum Flexibilität. Nur 20% des Kapitals konnten direkt als Kredite vergeben werden (der Rest war für die Absicherung von privaten Investitionen vorgesehen) und dies ausser in (nicht definierten) Ausnahmefällen nur für spezifische Projekte mit einem «produktiven Zweck».
Eine internationale Handelsorganisation
Während 1944 nur über den Währungsfonds und die Weltbank diskutiert und entschieden wurde, war aber von Anfang an eine internationale Handelsorganisation als dritter Pfeiler der Weltwirtschaftsordnung vorgesehen. Auch hier wollte man Zustände wie in der Zwischenkriegszeit verhindern, als sich Länder hinter hohen Zollmauern verschanzten und Handelskriege führten (Daunton setzt seinem Buch ein Zitat von Donald Trump voran: «Trade wars are easy to win»).
Nach den Enttäuschungen in Bretton Woods setzten die Länder des Globalen Südens, jetzt gestärkt durch die Unabhängigkeit des indischen Subkontinents, ihre Hoffnungen auf die Verhandlungen über die «International Trade Organisation» (ITO). Diese fanden 1947 in Genf und 1948 in Havanna statt. An der Havanna-Konferenz stellten die wenig industrialisierten «Entwicklungsländer» eine Mehrheit. Die Konferenz wurde vom Marshall-Plan überschattet; viele Länder des Globalen Südens hofften oder erwarteten, auch in den Genuss von Hilfe zu diesen Konditionen zu kommen. Zunehmend wurde ihnen aber klar, dass dies wohl nicht der Fall sein würde (auch wenn die offizielle Absage der USA erst nach der Konferenz kam). Unter der Führung lateinamerikanischer Länder und Indien nutzten die «Entwicklungsländer» ihre Mehrheit an der Havanna-Konferenz und verschärften die ITO-Charta mit ihren gescheiterten Forderungen aus Bretton Woods: einer Beschränkung des Freihandels, um eigene Industrien aufzubauen, Vorzugszölle und Rohstoffabkommen. Und in der ITO sollte das Prinzip «one country, one vote» gelten.

Professor Martin Daunton
Martin Daunton ist emeritierter Professor für Wirtschaftsgeschichte an der University of Cambridge. Zurzeit ist er Gastprofessor beim Gresham College in London.
Gewonnen war damit aber nichts, denn im Dezember 1950 entschied US-Präsident Truman, das Abkommen nicht dem Kongress zu unterbreiten. Die meisten anderen Industrieländer hatten ihre Zustimmung von den USA abhängig gemacht; und so starb die ITO Anfang der 50er Jahre einen stillen Tod. Übrig blieb das bereits 1947 verhandelte allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), das graduelle Zollsenkungen vorsah. Erst 1994 wurde unter ganz anderen Vorzeichen und nach siebenjährigen Verhandlungen mit der Gründung der Welthandelsorganisation WTO die Architektur so vervollständigt, wie es ursprünglich geplant war.
Die wirtschaftliche Nachkriegsordnung wurde von John Ruggie (dem späteren UN-Sonderbeauftragten für Unternehmen und Menschenrechte) als «embedded liberalism» bezeichnet. Für die Länder des Globalen Südens bedeutete diese Einbettung, so Martin Daunton, «eine spezifische Form des Neokolonialismus und eine globale Wirtschaft, die auf den Interessen der fortgeschrittenen Industrieländer beruht».
Ihre Forderungen lösten sich aber nicht einfach in Luft auf; sie wurden ab den Sechzigerjahren in der UNO wieder aufgenommen. Die De-Kolonisierung hatte deren Kreis der Mitglieder verändert; allein 1960 traten 16 afrikanische Länder der UNO bei. 1964 fand die erste United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) in Genf statt. In den 70er Jahren stand die Diskussion über «Economic Government of the World» unter dem Zeichen einer Neuen Weltwirtschaftsordnung (New International Economic Order), die der Süden auf die Agenda gesetzt hatte. Nach jahrelangen Verhandlungen versenkten Ronald Reagan und die lateinamerikanische Schuldenkrise in den Achtzigerjahren auch diesen Anlauf ergebnislos.
Viele der strukturellen Probleme, die der Süden in Bretton Woods aufgebracht hatte, sind bis heute ungelöst. Deshalb macht der Verweis auf diese Konferenz auch nach der Lektüre des Buches von Martin Daunton, das die Bedeutung der Konferenz relativiert, trotzdem Sinn. Dann nämlich, wenn er genau auf diesen Aspekt fokussiert, so wie das UNO-Generalsekretär António Guterres 2023 in der UNO-Generalversammlung sagte: «It is time for a new Bretton Woods moment. A new commitment to place the dramatic needs of developing countries at the centre of every decision and mechanism of the global financial system.»
Artikel teilen

global
Die Alliance Sud-Zeitschrift zu Nord/Süd-Fragen analysiert und kommentiert die Schweizer Aussen- und Entwicklungspolitik. «global» erscheint viermal jährlich und kann kostenlos abonniert werden.
Kommentar
In Abu Dhabi bestätigt sich die Krise der Globalisierung
02.03.2024, Handel und Investitionen
Am Freitagabend endete in Abu Dhabi die 13. Minister:innenkonferenz der WTO, ohne ein substanzielles Resultat zu erzielen. Lediglich zwei Moratorien wurden verlängert, darunter das zu elektronischen Übertragungen. Während sich China zur neuen Vorkämpferin einer Globalisierung neoliberaler Prägung entwickelt hat, halten sich die USA im Hintergrund. Derweil hat die Schweiz eine neue Verbündete, die mit Vorsicht zu behandeln ist.

© Alliance Sud / Isolda Agazzi
Nach mehrmaliger Verlängerung ging die 13. Minister:innenkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) in Abu Dhabi am späten Freitagabend zu Ende. Die Ausbeute ist mager: Die Mitgliedstaaten – inzwischen 166, nachdem an der Konferenz die Komoren und Osttimor beigetreten sind – schafften es bei kaum einem Thema, sich zu einigen.
In einer zunehmend fragmentierten Welt, lange von einem traditionellen Nord-Süd-Graben, aber seit geraumer Zeit auch durch wachsende Bruchlinien im Süden geprägt, will es der WTO nicht mehr gelingen, nach Konsensprinzip Entscheide zu fällen, so wie es ihre Statuten vorsehen. Aber auch unzählige plurilaterale Abkommen fanden im Plenum kein Gehör, da es die Mitglieder verpassten, deren Integration in die WTO in Betracht zu ziehen.
Keine Investitionserleichterungen durch die WTO
Am weitesten fortgeschritten war das 2017 in Buenos Aires initiierte und mittlerweile 124 Mitglieder umfassende Abkommen zur Erleichterung von Investitionen in Entwicklungsländern. Gefördert wurde es von China, mit Unterstützung von Ländern des Nordens sowie des Südens, jedoch nicht der USA, während die Europäische Union und die Schweiz an Bord waren. Aus Entwicklungsperspektive enthält das Abkommen hoch problematische Bestimmungen, obwohl es vorgibt, ebendiese Entwicklung voranzubringen.
So ermöglicht unter anderem eine Bestimmung zur «Transparenz» ausländischen, multinationalen Konzernen jegliche Gesetzes- und Verordnungsentwürfe, beispielsweise zu Umweltschutz oder Arbeitsrechten, bereits im Vorfeld zu kommentieren. Sollten die Konzerne mit den Entwürfen nicht einverstanden sein, könnten sie auf diese Weise Druck auf die nationalen Regierungen ausüben.
Das ist ein Einfallstor für weitere massive Deregulierungen zugunsten von Investitionen. Für China mag dies in Bezug auf seine Projekte entlang der Neuen Seidenstrasse äusserst vorteilhaft sein, aber es ist ganz bestimmt nicht im Interesse der Länder, die versuchen, sich einen gewissen Handlungsspielraum zu bewahren.
Südafrika, Indien und Indonesien wehrten sich bis zuletzt gegen eine Integration des Abkommens in die WTO, da sie dieses als illegal betrachten, und waren schliesslich erfolgreich. Die Befürworter des Abkommens beteuerten, dass diejenigen, die es nicht mitausgehandelt haben, von den Vorteilen profitieren würden, ohne dabei die Pflichten übernehmen zu müssen. Ein Argument, das die Gegenseite offensichtlich nicht überzeugen konnte. Die Frage bleibt nun, wie es mit dem Abkommen weitergeht, denn die Verhandlungen dazu sollen in Genf fortgeführt werden.
Moratorium gegen Zölle auf elektronische Übertragungen knapp verlängert
Ein weiterer wichtiger Schauplatz der Konferenz war die erneute Verlängerung des Moratoriums zu den Zöllen auf elektronische Übertragungen. Dabei geht es um das Verbot, Zölle zu erheben auf Filme, Musik und andere aus dem Internet herunterladbare Angebote und Dienstleistungen, sowie auf digitale Kommunikation.
Neben anderen Ländern wehrten sich abermals Indien, Südafrika und Indonesien entschieden gegen eine Verlängerung des Moratoriums. Sie sind der Ansicht, dass jedes Land selbst entscheiden sollte, ob es Zölle erheben möchte, um seine Industrie zu stärken und so seine digitale Souveränität sicherzustellen.
Die Vereinigten Staaten, die Schweiz, China und viele andere Staaten wollten das Moratorium unbedingt verlängern, doch diesmal war es ein harter Kampf. Um ihr Ziel zu erreichen, hätten die USA und die Schweiz womöglich bei einem anderen Moratorium nachgeben müssen, dessen Verlängerung sie ablehnen: Jenes zu Klagen bei Nichtverletzung des TRIPS-Abkommens, welches Indien und Südafrika im Gegenzug dringend verlängern wollen.
Diese unsägliche Bezeichnung steht für eine rechtliche Garantie für Länder, insbesondere Entwicklungsländer, dass sie nicht von einem anderen Mitgliedsstaat vor das WTO-Schiedsgericht gezerrt werden. Dies, wenn der Mitgliedsstaat der Meinung ist, seine Gewinne seien durch die Einführung anderer Massnahmen geschmälert worden, obwohl das TRIPS-Abkommen eingehalten wurde. Dabei ist es äusserst schwierig, ein konkretes Beispiel für einen solchen Fall zu nennen, da er aufgrund des geltenden Moratoriums nie eingetreten ist.
Scheitern bei Landwirtschaft und Fischerei
Auch sonst kamen keine substanziellen Ergebnisse zustande. Indien kämpfte bis zuletzt für eine dauerhafte Lösung in der Frage der Pflichtlagerhaltung in der Landwirtschaft. Diese würde es den Entwicklungsländern ermöglichen, ihre Bäuer:innen und Konsument:innen zu unterstützen, ohne eine Klage vor der WTO zu riskieren. Auf der Minister:innenkonferenz 2013 in Bali wurde eine Friedensklausel vereinbart, die so lange gelten sollte, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist. Diese ist jedoch nach wie vor nicht in Sicht.
Auch zu den Fischereisubventionen gab es keine Einigung; diesen Text lehnte auch die Zivilgesellschaft ab, da er ihrer Meinung nach die grossen Fischereibetriebe begünstigt hätte.
China, die neue Vorkämpferin einer wirtschaftsliberalen Globalisierung
Besonders China verkörpert das neue Gesicht der internationalen Handelsbeziehungen. Nach dem WTO-Beitritt im Jahr 2005 hielt sich China, die grosse Gewinnerin der Globalisierung, noch bedeckt. Nun drängt das Land hingegen bei den wirtschaftsliberalsten Abkommen und beim Abwärtswettlauf im Sozial- und Umweltbereich.
Die Vereinigten Staaten hingegen sind weniger wirtschaftsliberal als üblich, insbesondere wenn es um Investitionen geht. Sie haben kürzlich industriepolitische Massnahmen ergriffen, welche als protektionistisch beurteilt werden. Dasselbe im elektronischen Handel: Die Biden-Regierung versuchte jüngst, Big Tech sachte zu regulieren. Hinsichtlich Fischerei verlangten die Vereinigten Staaten, dass ein Text zum Verbot von Zwangsarbeit auf Hochseeschiffen aufgenommen wird, was China entschieden und letztlich erfolgreich ablehnte.
In vielen Bereichen hat die Schweiz mit China jetzt eine überraschende Verbündete. Allerdings wird sie darauf achten müssen, entsprechend auch die Einhaltung von Menschenrechten sowie von Sozial- und Umweltstandards einzufordern.
Die Konferenz hat vor allem gezeigt, dass die neoliberale Globalisierung, deren Speerspitze die WTO seit 29 Jahren ist, in der Krise steckt. Es ist mehr denn je an der Zeit, gerechtere internationale Handelsbeziehungen aufzubauen.
Artikel teilen
Artikel
13. WTO-Minister:innenkonferenz: Die Fata Morgana der Entwicklungspolitik
23.02.2024, Handel und Investitionen
Die dreizehnte Minister:innenkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) findet vom 26. – 29. Februar in Abu Dhabi statt. Investitionen, Klima, elektronische Übertragungen: Die Herausforderungen widerspiegeln einen immer gewichtigeren Nord-Süd-Graben – aber sie offenbaren auch Bruchstellen innerhalb des Globalen Südens.

Seit 2013 kein multilaterales Abkommen: An der WTO-Konferenz in Abu Dhabi drohen entwicklungspolitische Fortschritte im Sand zu verlaufen. Rub al-Chali Wüste auf emiratischem Gebiet.
© Shutterstock / Alexandre Caron
23 Jahre nach der Konferenz von Doha und der dortigen Lancierung der Entwicklungsagenda (sog. Doha-Runde) kehrt die Welthandelsorganisation (WTO) in die Golfstaaten zurück. Genauer gesagt nach Abu Dhabi, Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, wo während der letzten Februarwoche die dreizehnte Minister:innenkonferenz stattfinden wird.
Die Doha-Entwicklungsagenda wurde unmittelbar nach dem Schock der Terroranschläge vom 11. September verabschiedet, um die internationalen Handelsregeln zugunsten der Entwicklungsländer ausgewogener zu gestalten. Heute ist die Agenda bloss noch eine ferne Fata Morgana. Denn Fakt ist: Von den 100 ursprünglichen Vorschlägen sind lediglich zehn übriggeblieben, deren Substanz zudem immer mehr ausgehöhlt wurde.
Keine multilateralen Abkommen seit 2013 abgeschlossen
Es gilt anzuerkennen, dass sich die Welt in zwei Jahrzehnten tiefgreifend verändert hat. Indien, Südafrika, China und andere grosse Länder, die noch immer von ihrem Status als «Entwicklungsland» profitieren, lassen sich ihren jeweiligen Willen nicht mehr von den «entwickelten Ländern» (so die offizielle Bezeichnung) diktieren. Letztere sind insbesondere die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und die Schweiz.
Infolgedessen gelangt die WTO – die mit dem in Abu Dhabi geplanten Beitritt Osttimors und der Komoren 166 Mitglieder zählen wird – bei keinem Thema zu einer Übereinkunft. In einer Organisation, in der Entscheide nach Konsensprinzip getroffen werden – sprich kein Mitglied darf sich dagegenstellen – ist es ein unmögliches Unterfangen geworden, sich zu verständigen. So kam es zu keinem multilateralen Abkommen seit der Revision des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen an der Minister:innenkonferenz von Bali im Jahr 2013. Ausserdem bilden die Entwicklungsländer längst keinen homogenen Block mehr.
Plurilaterale Initiative zu Investitionen
Um dieses Hindernis zu umgehen, setzen bestimmte Länder, insbesondere die «entwickelten» Länder, in allerlei Bereichen vermehrt auf plurilaterale (also mehrere Länder umfassende) Initiativen. Das Investment Facilitation-Abkommen für Entwicklung, dessen Verhandlungen beim Minister:innentreffen von Buenos Aires im Jahr 2017 begannen, ist das am weitesten fortgeschrittene und könnte in Abu Dhabi verabschiedet werden. Lanciert von China mit der Unterstützung von 70 Ländern (darunter die Schweiz), umfasst es mittlerweile 110 Länder, darunter viele Entwicklungsländer.
Der traditionelle Graben zwischen Nord und Süd lässt sich hier aber nicht erkennen, ausser dass Indien und Südafrika die Initiative ablehnen. Dies taten sie bereits bei anderen plurilateralen Abkommen, weil sie befürchten, das multilaterale Prinzip werde weiter geschwächt.
Die Sorge der Zivilgesellschaft besteht darin, dass sich die Länder gezwungen sehen, ihre Türen für ausländische Investitionen zu öffnen, ohne sie kontrollieren oder einem entwicklungsdienlichen Rahmen unterstellen zu können. Das würde multinationalen Konzernen noch mehr Rechte einräumen. Zudem stellt sich die Frage, was mit einem Abkommen geschehen würde, das nicht von allen Mitgliedern ausgehandelt wurde.
Befürworter solch plurilateraler Ansätze argumentieren, dass bei Übernahme durch die WTO nur diejenigen Mitglieder, welche ein Abkommen ausgehandelt haben, an dessen Verpflichtungen gebunden wären. Die anderen würden lediglich von dessen Vorteilen profitieren.
Klima: Indien und Südafrika sperren sich gegen einseitige Massnahmen
Im Westen formiert sich bereits Widerstand gegen Indien, das sich traditionell als Fürsprecherin der Entwicklungsländer präsentiert. Gemeinsam mit seinem altbewährten Verbündeten Südafrika führt es den Aufstand gegen einseitige Umweltschutzmassnahmen an. Indien betrachtet diese als verschleierten Protektionismus und damit als Widerspruch zu den WTO-Prinzipien.
Besonders im Visier hat Indien den CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), eine von der EU eingeführte CO2-Grenzausgleichssteuer auf den Import von Produkten mit hohem Schadstoffausstoss, wie beispielsweise Aluminium aus Mosambik. Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD), die dieses Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiert, hat errechnet, dass die Auswirkungen auf das Klima minimal seien: Die Steuer würde die globalen CO2-Emissionen nur um 0,1 % senken. Das Einkommen der Industrieländer würde aber um 2,5 Mrd. US-Dollar steigen, während das Einkommen der Entwicklungsländer um 5,9 Mrd. US-Dollar reduziert würde.
Stattdessen empfiehlt die in Genf ansässige UNCTAD eine «positive Umweltagenda», die unter anderem den Transfer von grünen Technologien fördert.
Elektronische Übertragungen besteuern?
Schliesslich bleibt in Abu Dhabi auch die offene Frage zu klären, ob das zweijährige Moratorium bezüglich der Steuern auf elektronische Übertragungen verlängert wird. Es geht darum, ein weiteres Mal darauf zu verzichten, dass das Herunterladen von Filmen, Musik und Büchern sowie die Kommunikation über elektronische Nachrichten-Apps besteuert wird. Alliance Sud nahm an allen bisherigen WTO-Minister:innenkonferenzen seit deren Entstehung teil. Sie konnte beobachten, wie sehr die Schweiz jeweils zusammen mit den USA auf der Verlängerung des Moratoriums beharrte – ohne dabei jemals wirklich zu verstehen, woraus das Schweizer Interesse bestand. Die Schätzungen über die entgangenen Gewinne für die Entwicklungsländer variieren, aber sie belaufen sich mindestens auf zig Milliarden US-Dollar.
Alliance Sud wird auch an dieser 13. Minister:innenkonferenz teilnehmen. Sie wird in Abu Dhabi sein, um gemeinsam mit anderen NGOs aus der ganzen Welt sicherzustellen, dass die Errungenschaften der Entwicklungszusammenarbeit nicht in den sandigen Weiten der emiratischen Wüste zerrinnen.
Artikel teilen
Artikel
Rückbau der Globalisierung – langsam, aber sicher
22.06.2020, Handel und Investitionen
Der Ruf ist unüberhörbar geworden: Die in Billiglohnländer ausgelagerte Produktion soll zurückgebracht werden. So zwingend ein Paradigmenwechsel ist, so sorgfältig ist er anzugehen. Sonst bezahlen einmal mehr die Entwicklungsländer die Rechnung.

Auf der Ilha de Cabo, einer der angolanischen Hauptstadt Luanda vorgelagerten Insel.
© Alfredo D’Amato/Panos
Innerhalb weniger Monate hat ein erstmals in China aufgetauchtes Virus die Welt in die Knie gezwungen. Treffend als Virus der Globalisierung bezeichnet, hat es sich wie ein Lauffeuer in alle Ecken der Welt verbreitet. Einige argumentieren sogar, dass gewisse Länder nicht nur wegen ihres guten Krisenmanagements vergleichsweise glimpflich davongekommen seien, sondern weil sie schlecht in globale Wertschöpfungsketten integriert seien; andere, wie Italien, hätten genau darum einen sehr hohen Preis bezahlt, weil sie stark globalisiert und wirtschaftlich eng mit China verbunden seien.
Unbestritten ist, dass der grosse Lockdown, den rund die Hälfte der Menschheit vollzogen hat, unkalkulierbare Folgen für die Weltwirtschaft haben wird, vergleichbar mit der Weltwirtschaftskrise nach 1929. Es ist davon auszugehen, dass die aktuelle Krise enorme negative Folgen für die Entwicklungs- und Schwellenländer haben wird. Um ein Beispiel zu nennen: Der tunesische Wirtschaftswissenschaftler Sami Saya, der sich auf den Internationalen Währungsfonds (IWF) stützt, sagt voraus, dass Tunesien die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit 1956 erleben werde. In diesem sehr offenen Land ist der Tourismus einer der am stärksten betroffenen Sektoren. Bleibt der Luftraum auch nach der Lockerung des Ausnahmezustands noch länger geschlossen, so ist die Tourismussaison 2020 ernsthaft gefährdet, weiss auch der Präsident des tunesischen Hotelverbandes (FTH), Khaled Fakhfakh. Was das bedeutet, lässt sich an folgenden Zahlen ermessen: In Tunesien macht der Tourismus je nach Einschätzung zwischen 8% und 14% des Nationaleinkommens aus, fast jeder zehnte Arbeitsplatz hängt davon ab und die Ferienindustrie sichert 400 000 Familien den Lebensunterhalt.
Auf weniger volatile Sektoren setzen
In Europa, auf der anderen Seite des Mittelmeers, finden immer mehr Menschen, die Covidkrise sei eine beispiellose Chance für den Klimaschutz, angefangen damit, dass sie keinen Fuss mehr in ein Flugzeug setzen und die Ferien nicht nur dieses Jahr in Zugsreise-Distanz verbringen wollen. So lobenswert diese Absicht gerade auch im Kontext des Paradigmenwechsels der Uno-Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung ist, sie birgt auch die Gefahr, dass die Wirtschaft der von TouristInnen abhängigen Länder des Südens weiter in Schieflage gerät. Der Einwand liegt auf der Hand: Diese Länder seien eben schlecht beraten worden, hätten ein nicht nachhaltiges Entwicklungsmodell gewählt und auf einen volatilen Sektor par excellence gesetzt, der unter jedem Anschlag oder dem wachsenden ökologischen Bewusstsein in Europa leide.
Die tunesische Regierung hat dies lange vor der aktuellen Krise erkannt. Die FIPA (Foreign Investment Promotion Agency) lädt ausländische Investoren ein, in Sektoren zu investieren, die sie für vielversprechend hält und die eine hohe Wertschöpfung aufweisen: Mechanik, Elektrizität und Elektronik, Dienstleistungen (wie Call-Center), Kunststoffverarbeitung, Automobilkomponenten und Luftfahrt, aber auch traditionelle, arbeitsintensivere Sektoren wie die Textil- und Bekleidungsindustrie, die Lebensmittelverarbeitung, die Leder- und Schuhindustrie. Der Tourismus figuriert nicht auf dieser Liste, ihn zu ersetzen, wird jedoch Zeit brauchen.
Das Problem ist, dass die Abhängigkeit von ausländischen Investitionen in der Exportindustrie weder aus ökologischer noch aus wirtschaftlicher Sicht nachhaltig ist, da sie empfindlich auf durch externe Faktoren verursachte Krisen reagiert. Nach 2008 wurden Entwicklungs- und Schwellenländer speziell stark durch die Finanzkrise in Mitleidenschaft gezogen. Besonders betroffen waren jene Länder, die – oft unter dem Druck der Weltbank und des IWF – ein exportorientiertes Wirtschaftsmodell verfolgten und stark von ausländischen Direktinvestitionen abhängig geworden waren.
Arbeitslose Textilarbeiterinnen
Sicher, mit einem Zurückfahren der Globalisierung und der Verlagerung der Produktion zurück nach Europa und dessen Nachbarländer hätte der Textil- und Bekleidungssektor im Maghreb ein noch grösseres Potenzial als heute. Aber die Branche ist anfällig, weil sie stark von der internationalen Nachfrage abhängt. Während bei uns viele das Einfrieren unserer konsumgetriebenen Wirtschaft sogar begrüsst haben und die plötzliche Entschleunigung schätzten, führte die Schliessung von Warenhäusern und Modeboutiquen bei uns postwendend zur Schliessung von Textilfabriken und zur Entlassung von Millionen von Arbeitnehmerinnen in den Produktionsländern in Südostasien, meist ohne jegliche soziale Absicherung. Jetzt, wo die Produktion wieder hochgefahren wird, sind die Fabriken von miserablen Löhnen, die zwischen 150 und 200 US-Dollar pro Monat liegen – was meist nicht einmal zur Hälfte der Deckung der Grundbedürfnisse reicht –, zu noch tieferen Löhnen übergegangen. Die britische Risikoberatungsfirma Verisk Maplecroft wurde in der NZZ am Sonntag dahingehend zitiert, dass die etwas besseren Bedingungen, die sich die Textilarbeiterinnen in der Region in den letzten Jahren erkämpft haben, wieder zunichtegemacht werden dürften.
In Bangladesch, einem Land, das für seinen Kampf gegen die Armut und die Klimakrise viel Lob erhalten hat, kommen 80% der Devisen aus der Textilindustrie. Auch dieser Regierung kann man vorwerfen, dass sie sich für ein exportorientiertes Entwicklungsmodell und für die Komplizenschaft mit Konzernen und deren Zulieferern entschieden habe, die nicht bereit sind, für Jeans und ein Paar Turnschuhe etwas mehr zu bezahlen, was zu einem Wettlauf nach unten auf dem Rücken der arbeitenden Frauen führt.
Das Coronavirus hat die extreme Abhängigkeit vieler Länder von China gezeigt: 80% der Wirkstoffe der in Europa verkauften Medikamente werden im Reich der Mitte hergestellt, ein Prozentsatz, der für die Schweiz 27% beträgt. Die plötzliche Unterbrechung von Lieferketten und/oder die drohende Verlagerung bestimmter Produktionstätigkeiten sollte die Regierungen der Entwicklungsländer dazu veranlassen, sich einem Wirtschaftsmodell zuzuwenden, das sich auf die Stärkung der lokalen Wirtschaft und des Binnenmarktes konzentriert. Doch das ist leichter gesagt als getan; und vor allem lässt sich eine solche Umstellung nicht von heute auf morgen bewerkstelligen. Nicht zuletzt erfordert ein «interner» Markt auch eine entsprechend robuste Binnennachfrage, und das wiederum heisst, es braucht eine Einkommensumverteilung zugunsten der Masse der benachteiligten Menschen, die sich derzeit oft weder ausländische noch einheimische Produkte leisten können.
Aviatik am Boden, der Ölpreis sinkt
Ein weiterer Wirtschaftszweig, dessen Grounding nicht wenige begrüssten, war die Luftfahrt. Da fast alle Flugzeuge am Boden, aber auch Autos und Lastwagen wochenlang in ihren Garagen stehen geblieben sind, ist die Nachfrage nach Erdöl auf ein Allzeittief gefallen, der Preis für ein Barrel zeitweise sogar negativ geworden. Sicher, für das Klima sind das gute Nachrichten. Das Problem ist jedoch, dass viele Entwicklungsländer stark oder gar vollständig vom Export fossiler Brennstoffe abhängig sind: Südsudan, Nigeria, Angola, Ekuador, Irak und Algerien, um nur einige Beispiele zu nennen, haben ihre Wirtschaft nicht diversifiziert oder haben nichts anderes zu verkaufen. In Algerien entfallen fast alle Exporte und drei Viertel der Staatseinnahmen auf Öl und Gas. Jahrzehntelang versäumte es die kleptokratische Führungsriege in Algier, andere Sektoren als zusätzliche Einkommensquellen zu entwickeln. So gesehen kann das benachbarte Tunesien von Glück reden, dass es fast gänzlich ohne Rohstoffe auskommen muss. Immerhin, unter dem Druck der Strasse ist Algerien aufgewacht und hat beschlossen, seine Energieversorgung zu diversifizieren und die Ölrente zur Industrialisierung des Landes zu nutzen. Die Regierung steht kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens mit Deutschland über die Beteiligung an Desertec, einem gigantischen Solarstromprojekt in den Wüsten Nordafrikas, das 2003 unter der Ägide des Club of Rome lanciert wurde, aber ins Stocken geraten ist. Die neue algerische Regierung, die 2020 an die Macht gekommen ist, hat das Projekt wiederbelebt.
Die Covidkrise hat, noch viel schneller und abrupter als die Klimakrise, die Verwundbarkeit unserer globalisierten Welt aufgezeigt. Eine Anpassung ist notwendig, eine Neuorientierung drängt sich auf. Aber der Übergang zu einer Neuorganisation der Weltwirtschaft muss schrittweise und demokratisch gestaltet werden. Andernfalls droht die Heilung für die Entwicklungsländer schlimmere Konsequenzen zu haben als die Krankheit.
Artikel teilen
Meinung
WTO: Afrikas Revanche
15.02.2021, Handel und Investitionen
Die Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala ist die neue Chefin der Welthandelsorganisation (WTO) mit Sitz in Genf: Eine Premiere für Afrika und für eine Frau. Die Ökonomin muss sich nun für eine Entwicklung einsetzen, die niemanden zurücklässt.

Ngozi Okonjo-Iweala
© Isolda Agazzi
Die Wahl der 66-jährigen Ngozi ist nicht zu unterschätzen in einer Zeit, in der der Multilateralismus von allen Seiten untergraben wird und die WTO zum Stillstand gekommen ist. Aber was bedeutet schon "Stillstand"? Seit der Gründung der WTO im Jahr 1995 hat sich die Welt verändert und die Machtverhältnisse haben sich verschoben. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Industrieländer den Entwicklungsländern ihren Willen diktieren konnten. Die Entwicklungsländer lassen sich nicht mehr zu einer Liberalisierung zwingen, die vor allem den Interessen des Kapitals in den Ländern des Nordens dient.
Der Beweis: Seit dem Abkommen über Handelserleichterungen im Jahr 2015 wurde kein multilaterales, alle Mitglieder verpflichtendes Abkommen mehr geschlossen. In Buenos Aires einigte man sich 2017 darauf, plurilaterale Verhandlungen - in kleinen Gruppen – zu einigen wenigen Themen aufzunehmen: elektronischer Handel, Investitionserleichterungen, Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen und innerstaatliche Regelungen im Dienstleistungsbereich. Das einzige multilaterale Abkommen, das derzeit verhandelt wird, ist jenes über Fischereisubventionen, das eigentlich bis Ende 2020 hätte abgeschlossen werden sollen. Das war nicht der Fall und die TeilnehmerInnen hoffen, es noch vor der diesjährigen Ministerkonferenz in Kasachstan unter Dach und Fach zu bringen, falls sie denn überhaupt stattfindet.
Die meisten afrikanischen Länder nehmen nicht an den e-trade-Verhandlungen teil, mit der bemerkenswerten Ausnahme von Nigeria, das die Erklärung in Buenos Aires gleich zu Beginn mitunterzeichnete. Sie befürchten eine "digitale Kolonisierung" und glauben, dass sie zunächst ihren Zugang zum Internet verbessern müssen.
Neue Herausforderungen mit der Corona-Pandemie
Die Coronavirus-Krise hat neue Herausforderungen mit sich gebracht. Nach Schätzungen der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) werden die 47 ärmsten Länder der Welt (fast alle davon in Afrika) mit einem Rückgang ihres Bruttoinlandprodukts (BIP) um durchschnittlich 0,4% die schlechteste Wirtschaftsleistung der letzten 30 Jahre verzeichnen. Noch schlimmer: Die UNCTAD schätzt, dass in denselben Ländern zusätzliche 32 Millionen Menschen in die extreme Armut gedrängt wurden, wodurch jahrzehntelange Entwicklungsbemühungen zunichte gemacht wurden. Es wird erwartet, dass weltweit mehr als 100 Millionen Menschen unter die Armutsgrenze fallen werden.
In diesem Zusammenhang ist es wichtiger denn je, dass die WTO ein starkes Bekenntnis zu den armen Ländern abgibt und dass ihre Mitglieder sich bereit erklären, Handelsabkommen, die ihnen nicht viel gebracht haben, neu auszutarieren. Die Tatsache, dass eine afrikanische Frau zur Generaldirektorin gewählt wurde und dass sie ihr Engagement für Entwicklung bekräftigt hat, ist vielversprechend. Ein erleichterter Zugang für arme Länder zu Impfstoffen, Tests und anderen Schutzausrüstungen gegen Covid ist lebenswichtig, und es ist inakzeptabel, dass reiche Länder, einschliesslich der Schweiz, sich dem von Südafrika und Indien geforderten und von rund 50 Ländern unterstützten Verzicht auf geistige Eigentumsrechte in Zeiten der Pandemie widersetzen.
Die WTO muss den am wenigsten entwickelten Ländern (Least Developed Countries, LDCs) eine Befreiung von allen Verpflichtungen im Rahmen des TRIPS-Abkommens (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum) gewähren, solange sie LDCs sind und 12 Jahre darüber hinaus, wie sie es gerade beantragt haben – ein Antrag, der von der internationalen Zivilgesellschaft, darunter Alliance Sud, unterstützt wird.
Ngozi Okonjo-Iweala, überzeugte Liberale
Aber machen wir uns nichts vor: Ngozi Okonjo-Iweala war zweimal Nigerias Finanzministerin und arbeitete 25 Jahre lang bei der Weltbank, bis sie die Nummer zwei der Institution wurde. Sie ist also eine überzeugte Liberale, die die Privatisierungen in ihrem Land mit den uns bekannten dramatischen sozialen Folgen angeführt hat. Aber sie zeichnete sich auch im Kampf gegen die Korruption aus und erreichte eine Reduzierung der Staatsverschuldung um 65%.
2021 könnte das Jahr von Afrika werden. Am 1. Januar trat die Panafrikanische Freihandelszone (AfCFTA) in Kraft, eine der grössten Freihandelszonen der Welt mit 1,2 Milliarden Menschen und einem BIP von 2.500 Milliarden US-Dollar. Ein Fortschritt angesichts der Tatsache, dass der Handel zwischen den afrikanischen Ländern immer noch sehr begrenzt ist. Die regionale Integration könnte aber auch zu einem zweischneidigen Schwert für die Schwächsten werden: Kleinbauern, kleine Händler, indigene Völker. Freier Handel bringt immer Gewinner und Verlierer mit sich, sei es zwischen Ländern des Nordens und des Südens oder zwischen Ländern des Südens selbst – und die Verlierer müssen geschützt werden.
Heute wurde eine Afrikanerin an die Spitze der WTO gewählt. Hoffen wir, dass dies ein gutes Omen ist zu einer Zeit, in der Afrika eine beeindruckende Dynamik und einen eisernen Willen zeigt, die Coronavirus-Krise zu überwinden und seine Entwicklung fortzusetzen.
Artikel teilen
Artikel
Es braucht ein neues Aussenwirtschaftsgesetz
21.06.2021, Handel und Investitionen
Während die Menschenrechtsverletzungen zunehmen, wie die Beispiele von China und Myanmar zeigen, verfügt die Schweiz über keinerlei Rechtsgrundlagen, um rasch gezielte wirtschaftliche Massnahmen zu ergreifen.

Xinjiang, die autonome Region der UigurInnen in China, wird immer mehr zu einem «Freilicht-Gefängnis»: Die Polizei ist überall, Beten und Bärte sind in der Öffentlichkeit weitgehend verboten.
© Johannes Eisele / AFP
In den letzten drei Jahren häufen sich die Berichte über die Existenz von Internierungslagern für Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang und die dort praktizierte Zwangsarbeit. Die Beweise lassen sich nicht mehr leugnen, weshalb westliche Länder nun reagieren: Im März verhängte die Europäische Union (EU) Sanktionen gegen chinesische Beamte und ein staatliches Unternehmen. Norwegen, das wie die Schweiz Mitglied der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist, hat sich den Sanktionen angeschlossen.
Grossbritannien verabschiedete bereits am 12. Januar neue Regeln, die den Import von Produkten verbieten, bei denen der Verdacht besteht, dass sie das Ergebnis von Zwangsarbeit in Xinjiang sind. Kanada zog am selben Tag nach und kündigte Importbeschränkungen für Produkte aus Xinjiang an. In immer längeren Wertschöpfungsketten, in denen die Herstellung eines Produkts nicht mehr von A bis Z an einem Ort erfolgt, sondern die Komponenten in allen Erdteilen gefertigt und montiert werden, kann der Nachweis, dass ein bestimmtes Teil aus Zwangsarbeit stammt, kaum oder gar nicht erbracht werden. Daher schloss sich die EU dem Ansatz an, sich auf begründete Verdachtsmomente abzustützen.
Lückenlose Rückverfolgbarkeit unmöglich
Die USA gehen sogar noch weiter: Mit dem «Uyghur Human Rights Policy Act» und dem «Uyghur Forced Labour Prevention Act» hat der US-Kongress den Import von in Xinjiang hergestellten Produkten faktisch ganz verboten. Angesichts der Beweise für massive Menschenrechtsverletzungen müssen nun die US-amerikanischen Unternehmen und andere Akteure nachweisen, dass die in die USA importierten Produkte nicht aus Zwangsarbeit stammen – und nicht umgekehrt.
Die Schweiz ihrerseits verfolgt einen äusserst konservativen Ansatz und tut genau das Gegenteil: In seiner Antwort auf die Motion von Ständerat Carlo Sommaruga, den Import von Waren, die durch Zwangsarbeit in Xinjiang hergestellt wurden, zu verbieten, verwies der Bundesrat auf die Schwierigkeit einer vollständigen Rückverfolgbarkeit: «Die Überprüfung der Produktionsbedingungen im Ausland und somit der Einhaltung des Verbots von Zwangsarbeit kann durch die Bundesverwaltung nicht gewährleistet werden. Sie verfügt nicht über die Mittel und Möglichkeiten, jedes eingeführte Produkt sowie seine einzelnen Komponenten lückenlos zurückzuverfolgen.»
Schweiz verweist auf fehlende Gesetzesgrundlage
Die Beispiele anderer Länder zeigen: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. In der Schweiz ist dieser Wille nicht vorhanden. Sie ist politisch nicht bereit, ihre wirtschaftlichen Interessen an der Achtung der Menschenrechte auszurichten, nicht einmal bei so eklatanten Verstössen wie jenen gegen die Uiguren, die von immer mehr Rechtswissenschaftlern und Parlamenten aus aller Welt als Völkermord eingestuft werden.
Die einzige konkrete Massnahme, die der Bundesrat ergriffen hat, besteht in der Organisation eines Runden Tischs mit Vertretern der in Xinjiang ansässigen Textilindustrie, «um sie über die Situation zu informieren». Ein analoges Vorgehen ist für die Maschinenindustrie geplant. Für Alliance Sud, Public Eye und die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) – die sich während der Verhandlung des Freihandelsabkommens der Schweiz mit China in der so genannten China-Plattform zusammengeschlossen und diese nach Bekanntwerden der Internierungslager wiederbelebt haben – reicht das nicht. Dieser Meinung ist auch die UNO; Ende März erinnerte sie die Schweiz und 12 weitere Länder an ihre Verpflichtung, «sicherzustellen, dass Unternehmen, die in ihrem Territorium oder ihrer Gerichtsbarkeit ansässig sind, bei all ihren Tätigkeiten die Menschenrechte respektieren». Eine Abmahnung, auf die unser Land wahrscheinlich gerne verzichtet hätte.
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) begründet die Zurückhaltung der Schweiz mit dem Fehlen einer Gesetzesgrundlage. Der Bundesrat beschränkt sich darauf zu wiederholen, dass er von den einheimischen Unternehmen die Einhaltung einer Sorgfaltspflicht erwartet, verweigert sich aber weitergehenden Massnahmen.
Rahmenwerk soll auch das Zollrecht umfassen
Im Fall von Myanmar, wo der Militärputsch vom 1. Februar bereits mehr als 760 Tote gefordert hat, die Schweiz aber nur geringe wirtschaftliche Interessen hat, sieht es etwas besser aus. Dem Beispiel der EU und der USA folgend, hat die Schweiz Sanktionen gegen 11 hochrangige Militärs und gegen die beiden von ihnen kontrollierten Konglomerate verhängt: die Myanmar Economic Corporation (MEC), die hauptsächlich in den Bereichen Bergbau, Fertigung und Telekommunikation tätig ist, und die Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), die u. a. in den Bereichen Bankwesen, Bauwesen, Bergbau, Landwirtschaft, Tabak und Lebensmittelverarbeitung aktiv ist.
Was sollte angesichts dieser Untätigkeit respektive der variablen Geometrie der Ansätze getan werden? Die China-Plattform hat beim emeritierten Professor Thomas Cottier, einem Spezialisten für internationales Handelsrecht, ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Sein Vorschlag: Die Schweiz soll ein neues Aussenwirtschaftsgesetz verabschieden, das Wirtschaft und Menschenrechte miteinander verknüpft. Derzeit gilt das Bundesgesetz über aussenwirtschaftliche Massnahmen von 1982. Es besteht aber hauptsächlich aus technischen Verfahrensbestimmungen, beschränkt sich auf den Schutz der Schweizer Wirtschaft und macht keine inhaltlichen Vorgaben für die Politik.
«Ein neues Aussenwirtschaftsgesetz würde als Rahmenwerk fungieren, das auf bestehende Gesetze verweist, welche entsprechend angepasst und weiterentwickelt werden müssten. Dies gilt insbesondere für das Embargogesetz, das derzeit nur Massnahmen im Falle eines UN-Beschlusses oder Sanktionen der Haupthandelspartner, d. h. der EU oder der USA, erlaubt. Die Schweiz verfügt noch über keine Gesetzesgrundlage für eigenständige Wirtschaftssanktionen aufgrund von Menschenrechtsverletzungen. Inwieweit dies mit anderen Gesetzen vereinbar wäre, wäre noch im Detail zu prüfen», so Cottier.
Doch was wäre laut dem früheren Direktor des World Trade Institute der Mehrwert des neuen Gesetzes im Vergleich zu den bestehenden Gesetzen? «In der Schweiz gibt es bereits gesetzliche Grundlagen für Durchsetzungsmassnahmen bei Menschenrechtsverletzungen und Korruptionsstraftaten: zum Beispiel das Embargogesetz, das Güterkontrollgesetz, das Kriegsmaterialgesetz, das Rechtshilfegesetz, das Gesetz über unrechtmässig erworbene Vermögenswerte (Potentatengeldergesetz) und das Strafgesetzbuch. In das neue Gesetz müsste aber das gesamte Aussenwirtschaftsrecht aufgenommen werden, also auch das Zollrecht und insbesondere das Bundesgesetz über die Gewährung von Zollpräferenzen zugunsten der Entwicklungsländer, das derzeit nicht an Bedingungen geknüpft ist. Die Bundesverwaltung müsste eine Auslegeordnung erstellen, die das bereits Vorhandene und die Lücken beziehungsweise den Ergänzungsbedarf sichtbar machen würde.»
Damit würden die Kohärenz und Transparenz der schweizerischen Aussenwirtschaftspolitik sichergestellt und eine angemessene Reaktion auf eklatante Menschenrechtsverletzungen ermöglicht, unabhängig davon, welche wirtschaftlichen Interessen auf dem Spiel stehen.
Artikel teilen
Medienmitteilung
Corona: WTO muss endlich den Patentschutz aufheben
25.11.2021, Handel und Investitionen
Nächste Woche findet in Genf die WTO-Ministerkonferenz statt: Höchste Zeit, dass die Schweiz ihre destruktive Blockadehaltung, die seit über einem Jahr andauert, aufgibt und die Pharmahersteller ihr Wissen uneingeschränkt weitergeben.

© Tim Reckmann / pixelio.de
Die nächste Woche in Genf stattfindende WTO-Ministerkonferenz wird sich mit der vorübergehenden Aufhebung vom Urheberrechtsschutz in Zusammenhang mit Impfstoffen, Tests und Behandlungen gegen Covid-19 befassen. Höchste Zeit, dass die Schweiz ihre destruktive Blockadehaltung, die seit über einem Jahr andauert, aufgibt und die Pharmahersteller ihr Wissen uneingeschränkt weitergeben.
Nächste Woche spielt sich der weltweite Kampf gegen Covid-19 in Genf ab: Während die vierte Welle Europa fest im Griff hat, zeigt eine Studie der People's Vaccine Alliance, dass Pfizer, Moderna und BioNtech zusammen 65’000 US-Dollar pro Minute mit ihren mRNA-Impfstoffen verdienen, die notabene mit grosszügigen öffentlichen Geldern entwickelt wurden. Diese Profite sind umso skandalöser, als in reichen Ländern bereits eine dritte Impfstoffdosis verabreicht wird, während in Ländern mit niedrigem Einkommen gerade mal 2 Prozent der Bevölkerung die ersten beiden Dosen erhalten haben.
Im Fokus der am 30. November beginnenden WTO-Ministerkonferenz steht die von Indien und Südafrika im Oktober 2020 vorgeschlagene und von rund 100 Ländern unterstützte zeitlich begrenzte Aussetzung der Rechte zum Schutz des geistigen Eigentums für Impfstoffe, Tests und Medikamente zur Bekämpfung von Covid-19 (der sog. «TRIPS-Waiver»). Während sich selbst die USA zumindest für eine Aufhebung der Patente auf Impfstoffe ausgesprochen haben, wehrt sich die Schweiz als eines der letzten Länder weiter vehement dagegen.
Auch die Haltung der USA ist aber ungenügend, denn während sich die politische Aufmerksamkeit derzeit auf Impfstoffe konzentriert, zeichnet sich das Szenario des unfairen Zugangs auch für die Behandlung von Covid-19 ab. Weil teuer, patentiert und in unzureichenden Mengen produziert, werden diese von den wohlhabenden Ländern beschlagnahmt. Die aktuellen Beispiele des Entzündungshemmers Actemra von Roche und des antiviralen Medikaments Molnupiravir von Merck, die wegen restriktiver Handelslizenzen in Schwellenländern derzeit kaum verfügbar sind, zeigen einmal mehr die Notwendigkeit des TRIPS-Waivers. Auch der Zugang zu diagnostischen Tests bleibt ungleich verteilt, was die weltweite Bekämpfung der Pandemie weiter verzögert.
Es ist ebenso bezeichnend wie skandalös, dass die Schweiz als Sitzstaat von Pharmakonzernen und deren wichtigstem Dachverband, der International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), die TRIPS-Ausnahmeregelung blockiert und so die Interessen ihrer Industrie über das Menschenrecht auf Gesundheit stellt. Der Widerstand unseres Landes könnte die Ministerkonferenz zum Scheitern und Milliarden von Menschen um die medizinischen Mittel zur Bekämpfung von Covid-19 bringen. Deshalb muss die Schweiz die Ausnahmeregelung vom TRIPS-Abkommen endlich akzeptieren und Big Pharma ihre Technologien für die Herstellung von Impfstoffen, Tests und Medikamenten gegen Covid-19 freigeben.
Kontakte:
Isolda Agazzi, Fachverantwortliche «Handel und Investitionen» Alliance Sud, isolda.agazzi@alliancesud.ch; M +41 79 434 45 60
Patrick Durisch, Experte für Gesundheitspolitik, Public Eye, patrick.durisch@publiceye.ch, M +41 21 620 03 06
Artikel teilen

