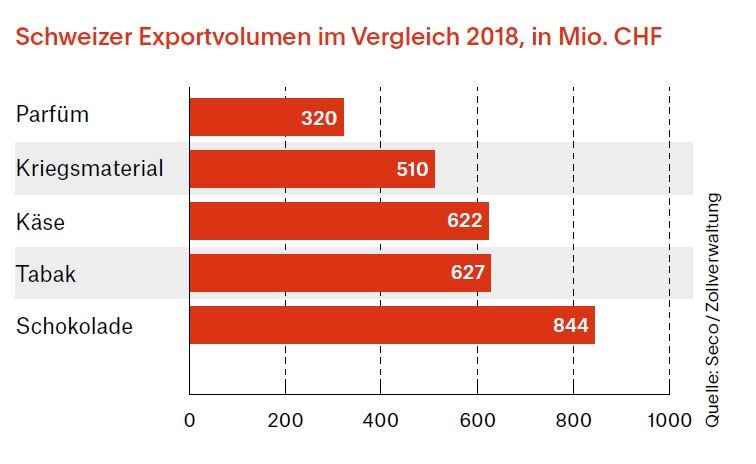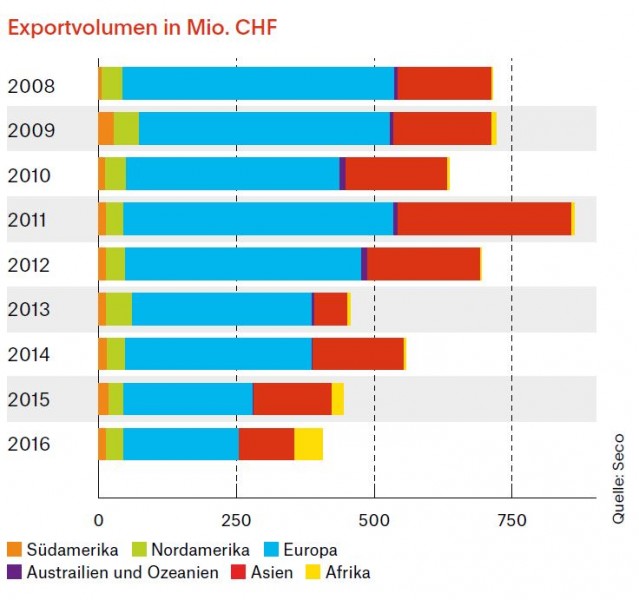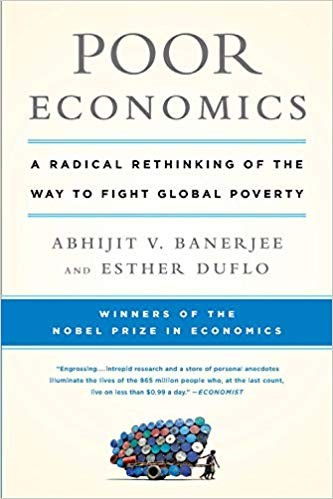Interview: Daniel Hitzig, ehemaliger Verantwortlicher für Medien und Kommunikation bei Alliance Sud
global: Welche persönlichen Eindrücke haben Sie von dieser Afrikareise mitgenommen?
Marina Carobbio: Es war eine sehr intensive und anspruchsvolle Reise. Das Gedenken an den Völkermord in Ruanda 1994 war ein sehr starker Moment. Die Menschen zu hören, die den Genozid persönlich überlebt haben, das hat mich sehr berührt. Es ist notwendig, daran zu erinnern, damit sich etwas Ähnliches nicht wiederholen kann. Dabei gibt es immer noch viele Orte, an denen es inakzeptable Angriffe auf Menschen und die Menschenrechte gibt. Die Reise hat mich sehr motiviert, mein Engagement für die Entwicklungszusammenarbeit fortzusetzen.
Dass die Wahl auf Ruanda und Mosambik fiel, war sicher kein Zufall.
Natürlich nicht. Es interessierte mich, die Rolle der Frauen in Schweizer Entwicklungsprojekten kennenzulernen, speziell wollte ich auch Projekte im Gesundheitswesen sehen. Wir wissen im Allgemeinen ja wenig über Afrika und Politiker und Politikerinnen sollten mehr darüber erfahren, was die Schweiz tut und was sie selbst aus dieser Zusammenarbeit lernen kann. Denn Entwicklung ist nie eine Einbahnstrasse. Bei meinen Besuchen stand die Rolle des Bundes im Vordergrund. Unser Land gilt als Vorbild in Sachen gute Regierungsführung und ist als zuverlässiger Partner anerkannt.
Die Schweiz verfügt über drei aussenpolitische Instrumente – die Entwicklungszusammenarbeit, die Friedens- und Menschenrechtsförderung sowie die humanitäre Hilfe. Was haben Sie bei Ihrem Besuch diesbezüglich erfahren?
In beiden Ländern haben wir Wasser- und Gesundheitsprojekte besucht, aber auch solche, mit denen Menschen unterstützt werden, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Auch Projekte im Bereich Public Private Partnership (PPP) haben wir gesehen und wir konnten beobachten, wie die Schweiz bei der Friedensförderung durch Dialog und die Beteiligung der Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle spielt. Das alles hat meine Überzeugung bestärkt, dass die Schweiz, wenn sie diese Arbeit fortsetzt, weiterhin und zunehmend als wichtige Akteurin auf der internationalen Bühne anerkannt wird. Es wäre ein Fehler, bestimmte Formen der Zusammenarbeit aufzugeben oder unsere Arbeit gar einzustellen. Sie ist für die Entwicklungsländer wichtig, aber eben auch für die Schweiz.
Mosambik ist eines der Schwerpunktländer der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz. Nach den Überschwemmungen forderten mehrere NGOs die Credit Suisse auf, Mosambik Schulden von einer Milliarde Dollar zu erlassen. Im Jahr 2016 hatten giftige Kredite das Land in eine schwere Schuldenkrise gestürzt. Es ist doch paradox, auf der einen Seite steht die staatliche Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz, auf der anderen Seite stürzt eine Schweizer Bank das Land in eine beispiellose Krise...
Das Problem ist, dass die Bank als privates Unternehmen wenig zur Klärung dieser Geschichte beiträgt. Das führt uns ohne Umweg zum Thema der Konzernverantwortungsinitiative. Auch wenn das Volksbegehren die Banken nicht direkt betrifft, ist das Thema der Sorgfaltspflicht von zentraler Bedeutung. In Mosambik haben wir bei offiziellen Treffen auch darüber gesprochen, wie wichtig die Bekämpfung der Korruption ist. In Ruanda habe ich festgestellt, wie heikel die Frage nach den Rohstoffen ist, die aus der Demokratischen Republik Kongo ins Land gelangen. Auch das erinnert uns wieder an unsere eigene Verantwortung, denn aus Ruanda gelangen Rohstoffe auch weiter zu uns.
Die Schweiz will gute Geschäfte machen, aber auch mit ihrer humanitären Tradition wahrgenommen werden. Wie erleben Sie diesen Spagat als Politikerin?
Der wirtschaftliche Erfolg ist zwar ein grundlegendes Thema, er darf aber nicht getrennt betrachtet werden von unserer Politik der Friedensförderung, des Umweltschutzes und der Menschenrechte. Es ist genau dieser Widerspruch, auf den die Konzernverantwortungsinitiative hinweist.
Die Gegner der Initiative sagen, das Anliegen sei zwar richtig, aber es genüge, wenn sich die Unternehmen freiwillig an Menschenrechte und Umweltstandards halten…
Wir haben auch in der Schweiz in vielen Bereichen festgestellt, dass freiwillige Standards nicht ausreichen, wenn es keine Regeln gibt. Nehmen wir nur das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Männer und Frauen!
So wie die Schweiz als Vermittlerin in Konfliktfällen einen guten Ruf hat, können wir auch beim verantwortungsbewussten Unternehmertum eine Vorbildrolle einnehmen.
Bundesrat Ignazio Cassis will die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit vermehrt an den Eigeninteressen der Schweiz ausrichten. Auch Migrationsaspekte sollen stärker gewichtet werden. Wird die Zusammenarbeit so nicht instrumentalisiert?
Die Zusammenarbeit darf nicht mit rein internen Zielen verknüpft werden. Für mich ist klar, dass wir mit einer guten Entwicklungspolitik auf der internationalen Bühne auch Ansehen gewinnen, wovon die Schweiz nur profitieren kann. Verknüpfen wir hingegen die Zusammenarbeit mit dem Ziel, dass weniger Menschen in die Schweiz migrieren, so stellen wir die ursprünglichen und primären Ziele der Zusammenarbeit in Frage.
Wir leben in einem stabilen Land, wo es den Menschen gut geht. Ausgehend von dieser privilegierten Situation muss die Entwicklungszusammenarbeit klar einen Diskurs der Solidarität führen. Auf diesem Wert – der Solidarität – ist die Schweiz gewachsen und den sollten wir heute nicht in Frage stellen.
Ist die internationale Zusammenarbeit in der Bevölkerung noch verankert?
Sie ist heute zwar weniger bekannt als in den 1980er und 1990er Jahren, aber es gibt immer noch viele junge Menschen, die sich im Ausland engagieren. In den Medien wird heute weniger über Entwicklungszusammenarbeit gesprochen. Wir erfahren zwar schnell von Katastrophen, die sich weit weg ereignet haben, reden etwa zwei Tage lang über einen Wirbelsturm und gehen dann zu einer anderen humanitären Krise über. Zusammenhänge kommen dabei eindeutig zu kurz. Mosambik war so ein Beispiel: Der Wirbelsturm an sich ist eine Naturkatastrophe, er trifft aber ein Land, das ohnehin schon sehr arm und stark vom Klimawandel betroffen ist.
Für viele gebildete Menschen im globalen Süden ist die «Entwicklungshilfe» des Nordens eine kaum kaschierte Form von Neokolonialismus. Da ist in den letzten dreissig Jahren einiges geschehen…
Ja, das stimmt. Zusammenarbeit darf eben nicht nur die Bereitstellung von Geld bedeuten, sondern muss auch auf die Ausbildung der Menschen zielen, damit sie in ihrem Land bleiben und arbeiten können. Die Zusammenarbeit muss so ausgerichtet sein, dass die Projekte selbstständig weitergeführt werden können. Ruanda, das habe ich mit eigenen Augen gesehen, hängt extrem stark von der internationalen Zusammenarbeit ab. In den Projekten, die wir mit der AMCA[1] fördern, spielt gerade die Ausbildung von Medizin- und Pflegepersonal eine zentrale Rolle, damit nicht alles von der Zusammenarbeit abhängt.
Gemäss dem Botschaftsentwurf zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 soll die Schweiz rund 0,45% ihres Nationaleinkommens (BIP) für die öffentliche Entwicklungshilfe aufwenden. Also weniger als die vom Parlament festgelegten 0,5%. Sie selbst setzen sich – wie es auch die Uno in den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) vorsieht – für 0,7% ein. Wie beurteilen sie das?
Es war ein gutes Zeichen, dass das Parlament im vergangenen Jahr beschloss, das Ziel von 0,5% beizubehalten. Ich wünschte mir aber nach wie vor, wie andere nördliche Länder 0,7% zu erreichen. Alliance Sud spielt mit ihrer Information aller ParlamentarierInnen in dieser Diskussion eine wichtige Rolle. Ich bin optimistisch und zuversichtlich, dass wir das Ziel von 0,5% beibehalten können.
2017 haben Sie während einer Konferenz zur Agenda 2030 eine Rede mit dem Titel "Agenda 2030 und politische Entscheidungen, welche Widersprüche gibt es?" gehalten. Welche Widersprüche sehen Sie in diesem Bereich?
Die Schweiz hat die Agenda 2030 und die Sustainable Development Goals (SDG) unterstützt, stellt gleichzeitig aber die finanziellen Ressourcen für die Entwicklungszusammenarbeit in Frage. Die SDGs sollen im Geist der Teilnahme und Teilhabe umgesetzt werden, zum Nutzen von Minderheiten, gegen Diskriminierung und zur Unterstützung der Geschlechterpolitik. Bei AMCA etwa haben wir ein Projekt zur Bekämpfung von Gebärmutterkrebs bei Frauen: In der Schweiz und im Tessin wurde eine Impfkampagne durchgeführt, parallel dazu haben wir in den Schulen erklärt, was diese Art von Krebs in armen Ländern für ein Drama ist. Vielleicht ist es einfacher, den Diskurs über Solidarität und Zusammenarbeit mit solchen praktischen Beispielen verständlich zu machen.
Als Nationalratspräsidentin und damit höchste Schweizerin können sie bestimmten Themen zu mehr Resonanz verhelfen. Was haben Sie sich vorgenommen?
Ich habe Themen ausgewählt, die durch meine eigene Erfahrung geprägt sind. Eine davon ist die Vertretung von Frauen in der Politik sowie die Gleichstellung. Ich habe mich immer für die Rechte der Frauen eingesetzt und war in der feministischen Bewegung engagiert. Ein anderes mir wichtiges Thema ist jenes der Minderheiten, ich bin eine Vertreterin der italienischen Schweiz und stehe ein für eine mehrsprachige und multikulturelle Schweiz.
Am 14. Juni streiken die Frauen. Warum finden Sie es so wichtig, dass die Frauen dann auf die Strasse gehen?
Schon 1991 kam der Streik von der Basis, von Frauenverbänden und Gewerkschaften. Es wird ja nicht bloss in Bern eine Demonstration geben, sondern auch lokale Aktivitäten. Viele werden den ganzen Tag streiken, andere nur eine Stunde lang symbolisch. Wenn mir vor fünf Jahren gesagt worden wäre, dass 2019 ein Jahr der Frauen sein würde, hätte ich es nicht geglaubt. Dank der Demonstration im vergangenen September in Bern wurde das Gesetz über die Lohngleichheit im Parlament nicht blockiert.
Wie hängen der Kampf um die Gleichstellung der Geschlechter und jener um soziale Gerechtigkeit zusammen?
Frauen spielen in beiden Kämpfen eine zentrale Rolle. Sie sind es, die sich um die Familie kümmern und eine zentrale Rolle beim Aufbau der Gesellschaft spielen. Wenn es Ruanda und Mosambik gelingen sollte, sich von der Abhängigkeit der klassischen Entwicklungszusammenarbeit zu lösen, dann nur dank der Frauen.
Die Frauenbewegung, die Gleichstellung und der Kampf gegen Diskriminierung sind eng mit der Frage der sozialen Gerechtigkeit verbunden. Wenn wir die Diskriminierung von Frauen bekämpfen, soll das immer auch in Richtung sozialer Gerechtigkeit gehen und sich gegen jenes Modell der patriarchalischen Gesellschaft richten, das es den Reichsten ermöglicht, über die Ärmsten zu herrschen.
Das Interview wurde auf Italienisch geführt.
Marina Carobbio Guscetti ist seit November 2018 Präsidentin des Schweizer Nationalrats und damit die amtshöchste Schweizerin. Von 1991 bis 2007 war sie Mitglied des Tessiner Grossrats, seit 2007 politisiert sie im Nationalrat, früher als Mitglied der Finanzkommission, heute in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Carobbio ist Vizepräsidentin der SP Schweiz, der NGO AMCA, des Vereins Alpeninitiative sowie des Schweizer Mieter- und Mieterinnenverbands.
[1] AMCA, die Vereinigung zur medizinischen Hilfe in Mittelamerika, wurde 1985 im Tessin gegründet.